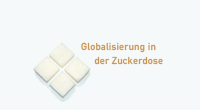
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Kritik an der Zuckermarktordnung (bis 30. Juni 2006) |
||||
 Kritik an der bis zum 30. Juni 2006 gültigen Zuckermarktordnung und Forderungen nach ihrer Reform kamen sowohl von Ländern außerhalb der EU als auch von den Zuckerverwendern in Europa (z.B. IZZ - Informationszentrum der Zuckerverwender). Kritisiert wurden insbesondere die folgenden Auswirkungen der ZMO. |
ÜberproduktionDie EU produziert Jahr für Jahr 20% mehr Zucker als sie verbraucht. Dies liegt daran, dass die A- und B- Quoten weit höher als der Ver- brauch in der EU festgelegt werden. Hinzu kommt, dass viele Produ- zenten noch deutlich mehr Zucker produzieren als durch die A- und B-Quoten erlaubt ist. Zu den eigenen Zuckerüber- schüssen der EU kommt zunehmend Zucker, den die EU im Rahmen verschiedener Abkommen importiert. Dazu zählen das AKP-Zuckerprotokoll sowie die Öffnung des EU-Marktes im Rahmen der Everything But Arms-Initiative sowie des Balkan-Abkommens. Deshalb wird von den Kritikern der ZMO eine substantielle Senkung oder auch die vollständige Abschaffung der Produktionsquoten für Zucker gefordert (5, 8 - 10).
|
Dumpingexporte Die Zuckerüberschüsse der EU summieren sich auf fünf
bis sechs Millionen Tonnen pro Jahr (4). Diese Überschüsse
müssen auf den Weltmarkt "entsorgt" werden (siehe
Zuckerexporte der
EU). Da die Produktionskosten für Zucker in der EU in
den meisten Jahren weit über dem Preisniveau für Zucker
am Weltmarkt liegen, ist der Export von EU-Zucker in Drittländer
nur unter Zahlung erheblicher Exportsubventionen möglich.
Die Kritiker der ZMO brandmarken diese Praxis als „Zuckerdumping“,
mit dem andere Länder wie Brasilien oder Thailand geschädigt
werden, die Zucker weit kostengünstiger als die EU produzieren
und exportieren können. |
||
| Quellen & Materialien |
|
|







