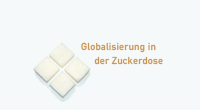
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Kulturgeschichte |
| Schleswig-Holstein
Dreieckshandel Schimmelmann Karibik Afrika Europa Ende der Sklaverei Gewinner & Verlierer Ausflugsziele |
Stationen des Dreieckhandels: |
||||
| Im 17. Jahrhundert erwarb Dänemark Kolonien in der Karibik: 1671 gründete die Dänisch-Westindische Handelskompanie ihre erste Handelsniederlassung auf St. Thomas, 1718 auf St. John. 1733 kaufte sie die Karibikinsel St. Croix von Frankreich. 1754 wurde St. Croix zusammen mit den beiden Inseln St. Thomas und St. John Kolonie des dänischen Königs. Die drei "Jungferninseln" waren zwar nur 400 km² groß, konnten aber intensiv für den Anbau von Kolonialprodukten genutzt werden. Schon bald dominierte der Zuckerrohranbau die Wirtschaft der drei Inseln. Insbesondere auf St. Croix entstanden ausgedehnte Zuckerrohrplantagen.
|
1763 stieg Heinrich Carl Schimmelmann in den lukrativen Zuckerrohr-Anbau ein und kaufte vier Plantagen auf den Jungferninseln. Außerdem erwarb er die größte dänische Zuckerfabrik in Kopenhagen. Auf seinen Plantagen auf den Jungferninseln ließ Schimmelmann vor allem Zucker und Rum produzieren. Letzterer machte etwa ein Viertel der Erträge aus und deckte alle laufenden Kosten. Der Erlös aus dem Zuckerverkauf war meist Reingewinn. Die Plantagen waren rentabel durch die Ausbeutung von Sklaven.
Nach ca. zwei Jahren hatte ein Sklave in der Regel seinen Kaufpreis
erwirtschaftet. Auf Grund unmenschlicher Lebens- und Arbeitsbedingungen
fiel die Arbeitsleistung vieler Sklaven innerhalb kurzer Zeit.
|
Viele starben an Unterernährung, Krankheiten und schlechter Behandlung. Deshalb waren die Plantagen auf den regelmäßigen Nachschub an Sklaven aus Afrika angewiesen.
1803 lebten auf St. Croix 30.000 Menschen. 26.500 davon waren Sklaven. Mit rund 1.000 Sklaven, die zu seinen Plantagen gehörten, war Schimmelmann einer der großen Sklavenhalter jener Zeit (2). |
||
|
| |








