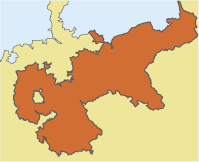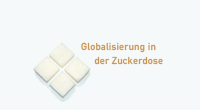
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Kulturgeschichte
Leben vor dem
Zucker Herkunft von Zuckerrohr Mittelalter Luxusgut Zucker Kolonialismus Zucker aus Rüben England |
| Schleswig-Holstein |
Nach dem Ende der Kontinentalsperre |
||||
| Nach dem Ende der Kontinental- sperre im Jahre 1813 überschwemmt England den kontinentaleuropäischen Markt mit Kolonialzucker. Die Zuckerpreise brechen ein und die Rübenzuckerindustrie ebenfalls. Sie kann nicht mit dem Kolonialzucker aus Sklavenarbeit konkurrieren. Erst ab 1834 erholt sie sich in Deutschland dank staatlicher Unterstützung. Zu dieser Zeit schließen sich einige deutsche Kleinstaaten mit Preußen zum Deutschen Zollverein zusammen. Dieser einheitliche Wirtschaftsraum erhebt hohe Zölle auf den Import kolonialen Rohrzuckers (1). In den folgenden Jahren nimmt die Herstellung von Zucker aus Rüben in Kontinentaleuropa einen rasanten Aufschwung. Um 1885 hat Rübenzucker in der Produktions- menge Rohrzucker überholt. |
Von Vorteil für den Rübenzucker ist, dass sich die Plantagenwirtschaft in der Karibik im Niedergang befindet. |
Nach dem Ende der Sklaverei fehlen billige Arbeitskräfte. Neue produktivere Rohrzucker- Anbaugebiete in Kuba oder den Philippinen erblühen erst ab dem Ende des 19.Jahrhunderts, als dort ebenfalls technologische Verbesserungen wie die Eisenbahn und das Konzept der Zentralmühlen Einzug halten (3). Der Rübenzucker zerbricht das über Jahrhunderte bestehende Monopol des Kolonialzuckers. Der resultierende Preisverfall für Zucker auf den europäischen Märkten ist einer der Faktoren, die zum Ende der Sklaverei führen (1 + 3). |
||
|
| |