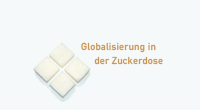
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Entdeckung |
| Gewinnaufteilung
Patente Internat. Abkommen Biopiraterie Lösungsvorschläge |
Die Konvention über die biologische
Vielfalt |
||||
| Die Konvention über die biologische Vielfalt ist seit Ende 1993 als völkerrechtlich verbindliches Abkommen in Kraft. Ihre Hauptziele sind der Schutz der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile („Benefit Sharing“). Die bisher über 180 Unterzeichner- staaten verpflichten
sich, ent- sprechende nationale Programme zu entwickeln, um u.a.
den Entwick- lungsländern besseren Zugang zu den Ergebnissen
der biotechno- logischen Forschung zu gewähren. Finanziert
wird dies über den von der Weltbank mitgegrün- deten
Globalen Umweltfond (Global Environmental Facility – GEF)
(1) CBD - Convention on Biological Diversity: www.biodiv.org
|
Die biologische Vielfalt ist wichtig für das globale Überleben. Die Biodiversitäts-Konvention trägt dieser Erkenntnis Rechnung und wurde von der deutschen Bundes- regierung von Beginn an unterstützt, beispielsweise durch eine Vielzahl von Projektmaß- nahmen in den Bereichen Naturschutz, ländliche Entwicklung, Fischerei und Waldwirtschaft. Dem Transfer von Informationen und Technologie wird dabei eine Schlüsselstellung bei der Umsetzung der Konvention eingeräumt (4). Der umfassende Ansatz der Konvention ist zeitgemäß, gleichzeitig aber ein Grund für ihre langsame Umsetzung. Durch diesen Ansatz werden Naturschutz und -erhaltung mit einem Regelungsprozess für die nachhaltige Nutzung sowie einem gerechten Vorteilsausgleich verbunden (1). |
Aufgrund der vielfältigen damit verbundenen Themen verzögert sich die Umsetzung der Konvention. Zudem wird die Einhaltung der Ziele der Konvention bisher kaum kontrolliert. Auch fehlen diesbezügliche Sanktions- mechanismen. Der Begriff der biologischen Vielfalt – kurz Biodiversität – bezieht sich auf die Vielfalt der in der Natur vorkommenden Arten von Tieren und Pflanzen. Deshalb werden in der Biodiversitäts-Konvention Fragen der Züchtung sowie die Gentechnik ausgeklammert. Diese Lücke schließt die Welternährungsorganisation FAO (Food and Agriculture Organisation) durch das Abkommen über pflanzengenetische Ressourcen (2). |
||
|
|
|







