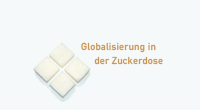
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Definition |
| Akteure |
| Geschichte |
| Zucker auf den Philippinen |
Das Konzept des Fairen Handels |
||||
| Es gibt zwei Hauptformen des „Fairen Handels“. Einerseits existiert der Verkauf als „fair gehandelt“ zertifizierter Produkte über konventionelle Vertriebsstrukturen wie Supermärkte und Discounter. Eine solche Zertifizierung führt zum Beispiel der Verein TransFair durch. Auf der anderen Seite gibt es den "Alternativen Handel", der ausschließlich alternative Vertriebswege wie Weltläden nutzt.
|

Einige Definitionen: "Er ist eine Handelspartnerschaft, die eine nachhaltige
Entwicklung für ausgeschlossene und benachteiligte ProduzentInnen
anstrebt. Er versucht das durch die Gewährung besserer Handels-
bedingungen, durch Bewusst- seinsbildung und Kampagnen".
Diese unterscheidet sich von rein kommerziellen Handelsbe- ziehungen
konzeptionell (1). |
Während diese Definitionsansätze vor allem die Zielgruppen des Fairen Handels und den Handelscharakter betonen, legt die Organisation der Produzenten (International Fair Trade Organisation – IFAT) das Augenmerk auf die politischen Ziele (2). Das bedeutet, der Faire Handel strebt nach Veränderungen im internationalen Handel hin zu mehr Gerechtigkeit insbesondere für den Süden. Wie diese Ziele zu erreichen sind, ist in den Kriterien des Fairen Handels festgelegt. |
||
|
|
|








