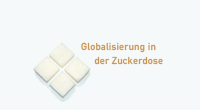
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Definition |
| Akteure |
| Geschichte |
| Zucker auf den Philippinen |
Die Kriterien des Fairen Handels
erläutert |
||||
| Um am Fairen Handel teilnehmen zu können, müssen die Produzenten nicht alle dieser Kriterien erfüllen. Diese dienen vielmehr als Ziel, welches die Teilnehmer durch den Fairen Handel erreichen sollen. Der Faire Preis wird in der Regel zwischen den Fair-Handelsorganisationen
und Produzenten ausgehandelt. Der Preis soll den Produzenten einen
angemessenen Anteil am Gesamtgewinn sichern und dafür sorgen,
dass sie ein Einkommen erzielen, das ihren Lebensunterhalt sichert.
Er liegt immer etwa 10% über dem Weltmarktpreis und unterschreitet
nie einen festgelegten Wert. Darüber hinaus ist in diesem
Preis ein so genannter "Entwicklungsaufschlag" enthalten,
der zur Finanzierung von Projekten bei den Produzenten verwendet
wird. |
Damit ein möglichst großer Teil vom Endverbraucherpreis beim Produzenten ankommt, werden Zwischenhändler umgangen und die Erzeugnisse direkt exportiert. Die Handelsbeziehungen im Fairen Handel sind langfristig und
schließen das Recht auf Vorfinanzierung ein. Zuckerrohr
beispielsweise wird nur einmal im Jahr geerntet. Oft reichen die
Erlöse des Zuckerrohrs jedoch nicht, um den Anbau und die
Lebenshaltungskosten bis zur nächsten Ernte zu finanzieren.
Um eine Verschuldung der Kleinproduzenten zu vermeiden, wird die
Fair-Handelsorganisation zum Kreditgeber und zahlt an die Vermarktungsorganisation
– zum Beispiel die Alter Trade Corporation (ATC) (siehe
Zucker auf den Philippinen)
– "Vorschüsse", die nach der Ernte mit der
nächsten Lieferung zurückgezahlt werden.
|

Ein Kleinproduzent bei der Zuckerrohr-Ernte Auf diese Weise wird das Risiko zwischen den Produzenten (die in Vorleistung treten und riskieren, ihre Ware ggf. nicht absetzen zu können) und der Handelsorganisation (die eine Anzahlung leistet und riskiert, die Ware nicht in der benötigten Menge und Qualität zu erhalten) gleichmäßiger verteilt (1). |
||
|
|
|







