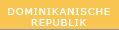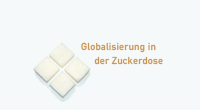
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Zuckerproduktion |
| Zuckerindustrie |
| Menschenrechte |
| Maissirup & CAFTA |
| Sozialstandards
Definition Pro Contra Standards |
| Landeskunde |
Was spricht gegen internationale
Standards? |
|||||
Gegen die Einführung von Umwelt- und Sozialstandards spricht, dass die Nichteinhaltung bestimmter Standards ein Kostenvorteil der Entwicklungsländer ist, den sie benötigen, um ihre wirtschaftliche und soziale "Unterentwicklung" durch wirtschaftliche Entwicklung zu überwinden. Es wird befürchtet, dass durch Sozialstandards dem Protektionismus Tür und Tor geöffnet ist, insbesondere dann, wenn diese Standards einseitig durchgesetzt werden können, wie z.B. von den USA praktiziert (Allg. Präferenzsystem ASP). Vor allem Entwicklungsländer haben erhebliche Befürchtungen, dass Sozialstandards Handelsschranken ersetzen könnten. Außerdem steigen durch die Einführung verbindlicher Regeln zunächst die (betriebswirtschaft- lichen) Kosten, auch wenn
|
sie langfristig durch höhere Produktivität wieder sinken (1). Daneben stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit solcher Standards. Trifft man mit Handelssanktionen die Wirtschaftssektoren, wo die schlimmsten Bedingungen herrschen? Wie wird die Einhaltung der Standards kontrolliert? Fragwürdig wären Standards zudem dann, wenn ein von
Sanktionen betroffenes Land ohne Unterstützung von außen
überhaupt nicht in der Lage ist, derartige Standards einzuführen.
|
|
|||
|