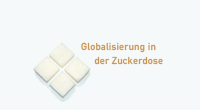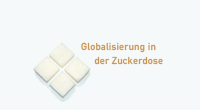|
|
Protokoll der Anhörung am 08.11.2004
|
| Lesen Sie das vollständige Protokoll hier.
| Video |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Ich begrüße Sie heute Morgen ganz herzlich. Ich eröffne
die 52. Sitzung des Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft und die öffentliche Anhörung zum Thema:
Reform der EU-Zuckermarktordnung. |
| |
Ich möchte ganz herzlich neben den Kolleginnen und Kollegen
aus dem Verbraucherausschuss auch die Kollegen aus dem Auswärtigen
Ausschuss sowie des Innenausschusses begrüßen. Es werden
sicher auch noch einige anreisen, wie übrigens auch Sachverständige,
die wegen des frühen Beginns noch nicht anreisen konnten
und natürlich unsere Gäste, ebenso die Staatssekretäre,
die Herren Matthias Berninger und Gerald Thalheim und natürlich
auch die Dolmetscherinnen, Frau Barbian und Frau Mayes.
Ich habe auch schon mitbekommen, dass einige von Ihnen genauso
früh aufstehen mussten wie ich, nämlich um halb vier, d.
h. wir werden gemeinsam bei diesem wichtigen Thema wieder
wach werden und wichtig ist das Thema, da besteht ja gar
kein Zweifel daran, sowohl für die deutsche Wirtschaft,
die Landwirtschaft, die Zuckerindustrie, aber natürlich
auch für die Seite der Entwicklungsländer, der Schwellenländer
und natürlich im Hinblick auf die anstehenden WTOVerhandlungen.
Nicht zuletzt hat ja auch die Ausrichtung der gemeinsamen
Agrarpolitik den Reformbedarf deutlich gemacht. Ich denke
es wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass reformiert
wird, dass geändert wird, aber wir werden uns jetzt darüber
unterhalten, wie die Zuckermarktordnung der neuen Entwicklung
angepasst werden soll und kann. Und zu diesem Zwecke begrüße
ich an aller vorderster Stelle unsere Sachverständigen ganz
herzlich. Die EU-Kommission hat ja eine Reihe von Vorschlägen
vorgelegt, auch daran werden wir uns orientieren, ganz aktuell
auch die Entscheidungen bzw. die Verfahren vor dem WTO-Schiedsgericht
und ich hoffe, dass wir innerhalb der nächsten Stunden mit
Ihnen gemeinsam zu einem Klärungsprozess kommen können,
der dann in unsere Arbeit des Verbraucherausschusses und
der anderen Ausschüsse einfließen kann. Noch einige Infos
dazu: Das Parlamentsfernsehen wird die Debatte hier aufzeichnen.
Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind alle an die
Abgeordneten per Post und per E-Mail übermittelt worden.
Sie liegen auch draußen noch einmal aus. Ganz herzlichen
Dank für die Beantwortung unserer Fragen an Sie. Der zeitliche
Rahmen: Also wir hoffen schon, dass wir bis 14.00 Uhr fertig
sein können. Das wollen wir uns ungefähr als Ziel nehmen.
Die Bewirtung – Sie sehen dort die Wagen – dort können Sie
sich verpflegen über diese Zeit hinweg und ich denke, wir
sollten jetzt beginnen mit einem kurzen Statement der Sachverständigen,
5 bis 7 Minuten, wo Sie uns Ihre Hauptaussage noch einmal
vermitteln. Bedenken Sie, dass die Abgeordneten natürlich
einen Teil schon gelesen haben, aber ich denke, hier für
die Diskussion ist es wichtig, dass Ihre Hauptbotschaften
hier ankommen und Herr Prof. Isermeyer, ich würde Sie bitten,
jetzt zu beginnen. |
| Video |
Prof. Folkhard Isermeyer, Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft, FAL: |
| |
Herzlichen Dank Frau Höfken. Meine sehr geehrten Damen
und Herren, ich glaube es besteht kein Zweifel, dass die
Zuckermarktordnung in der Tat vor einer Reform steht. Ich
glaube, dass es im Unterschied zu früheren Zeiten nun so
ist, dass die Zuckermarktordnung von ganz allein im Laufe
der Zeit kippen würde, wenn die Politik gar nichts machen
würde. Nicht nur wegen der beiden angesprochenen WTO-Verfahren,
sondern auch und vor allem deshalb, weil mit dem EBA-Abkommen
eine riesige Saugpumpe in Gang gesetzt worden ist, die es
für die ärmsten Länder der Welt attraktiv erscheinen lässt,
im Laufe der Zeit immer mehr Zucker in diesen hochpreisigen
europäischen Markt hinein zu bringen. Darauf wird man dann,
wenn eben keine Zuckerexporte mehr möglich sind, irgendwann
nur mit drastischen Quotenrücknahmen reagieren können bis
hin zum Kollaps der Zuckermarktordnung. Die Politik muss
also etwas tun und die EU-Kommission hat nun vorgeschlagen,
in der Weise zu verfahren, dass man die Quoten relativ gering,
dafür aber den Preis sehr stark zurücknimmt. |
| |
Das Kernargument hierfür, so wie ich es jedenfalls bisher
verstanden habe, ist, dass die EUKommission die Hoffnung
hat, dass dann, wenn man die Preise in die Region von 420,-
Euro pro Tonne Zucker herunter nimmt, es für die Zuckerrohr
anbauenden Länder nicht mehr wirtschaftlich attraktiv sein
wird ihre Produktion und den Export in die EU auszuweiten.
Zur Begründung dieses Kernargumentes führt die EU-Kommission
eine ganze Reihe von Produktionskostenzahlen für Zuckerrohr
in verschiedenen Ländern der Welt an und hier muss ich aus
wissenschaftlicher Sicht einhaken und sagen, dass ich diese
Quelle, die die EU-Kommission hier angibt, nicht habe. Meines
Wissens hat auch keiner der Fachkollegen in der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit diese Quelle. Unser Institut macht sehr viele
internationale vergleichende Kostenstudien in anderen Feldern
und wenn ich einmal das, was wir z. B. im Laufe der Zeit
im Bereich Milch entwickelt haben, übertrage auf das, was
bei Zucker hier angedeutet wird, habe ich ein großes Fragezeichen
zumindest in soweit, ob diese internationalen Produktionskostenziffern
wirklich nachher der Realität entsprechen. Das ist deswegen
von so großer Bedeutung, weil, wenn sich die EU-Kommission
bzw. Amnesty International, die diese Zahlen unseres Wissens
nach produziert hat, verschätzen, die Preissenkung auf 420,-
Euro pro Tonne nicht ausreicht. Dann wird dieser Importstrom
von Weltmarktzucker in die EU anhalten, er wird fortgesetzt
werden. Und das würde uns zwingen, unseren internen Preis
noch weiter abzusenken, um zu einem Marktgleichgewicht zu
kommen. Dann kommen wir in eine Region hinein, wo unsere
Zuckerwirtschaft, auch unsere Rüben anbauenden Betriebe
nicht mehr mit können, d. h. dann kollabiert dieses System
eben doch. Deswegen ist es so wichtig, bessere Kenntnis
von der Angebotselastizität der Zuckerproduktion in anderen
Teilen der Welt zu haben, als es bisher zumindest im wissenschaftlichen
Bereich der Fall ist. |
| |
Ich will ein bisschen noch weiter nach vorne schauen.
Die Grundphilosophie der europäischen Agrarreform in den
anderen Sektoren liegt ja darin, dass wir die Stützung der
Landwirtschaft von der Marktstützung entkoppeln und damit
die Landwirtschaft stärker mit Marktsignalen versorgen,
damit die Landwirtschaft allmählich wettbewerbsfähiger wird,
mit der fernen Zielsetzung, dann eines Tages die Landwirtschaft
wirklich in einen weltweiten Wettbewerb entlassen zu können.
Also die Strategie kann man umschreiben mit den Worten: |
| |
Fit machen für den Wettbewerb. Und bei Zucker kann man
Zweifel haben, ob diese Strategie funktioniert. Bei Milch,
bei Rindfleisch, bei vielen anderen Problemprodukten der
deutschen Landwirtschaft habe ich da gar keinen Zweifel,
da wird sie funktionieren. Bei Zucker habe ich Zweifel,
weil wir bei Zucker insgesamt nur relativ wenig Agrarfläche
auf diesem Globus brauchen, um die Welt mit Süße zu versorgen
und weil wir diese besondere Konstellation Zuckerrohr gegen
Zuckerrübe haben und Zuckerrohr in einer ganzen Reihe von
Ländern sehr preisgünstig angebaut werden kann. Es gibt
Studien, die zeigen, dass eine ganze Reihe von Ländern für
200,- Euro pro Tonne Zucker produzieren können und allein
Brasilien, dieses Beispiel wurde ja oft zitiert, kann durch
Umlenkung von Zuckerrohrströmen raus aus dem Kraftstoffbereich
hinein in den Zuckerweltmarkt und durch Ausdehnung der Zuckerrohrfläche
relativ leicht, die gesamte Zuckerrübenproduktion der USA
und Europas ersetzen. D. h., diese Strategie: |
| |
Fit machen für den Weltmarkt könnte bei Zucker ins Leere
laufen und damit stellt sich die Frage: |
| |
Wo wollen wir eigentlich langfristig hin? Diese Frage
kann ich als Wissenschaftler nur zurückgeben an die Politik
und fragen: Haben wir ein langfristiges zuckerpolitisches
Ziel, dass also eine Eigenversorgung mit Zucker als Selbstzweck
anerkannt wird oder machen wir es wie Neuseeland beispielsweise,
die sagen, wir haben kein zuckerpolitisches Ziel, wir versorgen
uns mit Zucker von den Fidschi-Inseln auf der Basis von
Zuckerrohr. |
| |
Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, folgen
für die Zuckermarktreform m. E. ganz unterschiedliche Strategien.
Denn wenn wir langfristig kein eigenständiges zuckerpolitisches
Ziel verfolgen wollen, müssten wir in eine Art Abwicklungsstrategie
hineingehen. Wenn wir aber ein zuckerpolitisches Ziel haben,
dann müssten wir uns Bündnispartner suchen, und da sind
sicherlich die ärmsten Länder der Welt und die Nordamerikaner
zu nennen, um in einer multilateralen Verhandlung im Rahmen
der laufenden WTO-Runde eine weltweite Mengenregulierung
herbeizuführen. Ich glaube diese Frage wird uns im Laufe
der Diskussion heute noch ein bisschen beschäftigen. Ich
kann diese Zielfrage als Wissenschaftler nicht beantworten,
ich will sie auch nicht beantworten. Nur wenn wir diese
Langfriststrategie - wir wollen Zucker behalten - verfolgen,
dann brauchen wir Bündnispartner und denen müssen wir etwas
anbieten und für die ärmsten Länder der Welt ist es wahrscheinlich
nicht besonders attraktiv, wenn die Europäische Union bei
einer Quotenkürzung von 16 % stehen bleibt, dann erwarte
ich, dass wir die Quote deutlich stärker zurücknehmen müssten.
Es bestünde aber nicht der Zwang, jetzt schon die Preise
so stark zurückzunehmen, wie von der Europäischen Kommission
vorgeschlagen. Es hängt also letztlich von der Frage des
politischen Ziels ab, was die richtige Strategie sein wird.Herzlichen
Dank. |
| Video |
Dr. Rudolf Buntzel-Cano, Beauftragter für Welternährungsfragen
in der Fachstelle Landwirtschaft/Welternährung des Evangelischen
Entwicklungsdienstes, EED: |
| |
Seien Sie auch gegrüßt. Ich komme vom Evangelischen Entwicklungsdienst,
spreche hier aber auch für ein Bündnis von 13 Nichtregierungsorganisationen.
Wir haben uns mit der Zuckermarktordnung sehr stark beschäftigt,
vor allem auch aus entwicklungspolitischer Sicht. Lassen
Sie mich kurz eine Vorbemerkung machen, warum die Frage
jetzt auch noch aus entwicklungspolitischer Sicht beleuchtet
werden soll, wo wir doch nun genug Probleme mit der Verteilungswirkung,
den Einkommenswirkungen und den regionalpolitischen Wirkungen
haben. Die Entwicklungsländer werden von allen Seiten immer
wieder herangezogen, um die eigenen Positionen einfach nur
abzusichern. Wir müssen aber sehen, dass wir es hier mit
einem weltgeschichtlichen Problem zu tun haben. Denn Zucker
ist das Welthandelsprodukt per excellance. Mit Zucker ist
der Kolonialismus entstanden, der Sklavenhandel, die Besitznahme
und Besiedlung Lateinamerikas und auch der Weltagrarhandel
ist mit Zucker insgesamt entstanden. Aber auch mit dem Aufkommen
der Zuckerrübe unter Napoleon und dem europäischen Agrarprotektionismus,
der sich immer auch schon von damals her im Kontrast zum
Zuckerrohr verstanden hat, weil damals Zuckerrohr angeblich
sozial unerträglich war im Zusammenhang mit der Bekämpfung
des Sklavenhandels, wurde die Zuckerrübe hier hochgehalten
und langsam in Europa forciert. Die Grundkonstellation haben
wir heute immer noch und die jetzige Debatte zeigt es ja
sehr deutlich. Die Konkurrenz Rübe/Rohr, der ungerechte
Handel im Zusammenhang mit Zucker und die krassen sozialen
Bedingungen auf den Plantagen im Süden dieses Kontinents
müssen auch heute noch herhalten für unseren Protektionismus.
Also die Entwicklungsländerproblematik ist nicht irgendetwas
zusätzliches, sondern ist der Kern der gesamten Problematik. |
| |
Zunächst einmal sehen wir das Hauptproblem darin, das
wir einfach zu viel produzieren, obwohl wir eine Quotenregulierung
haben, eigentlich ein ideales Instrument, um die Mengen
zu steuern. Nur wurden sie nicht gesteuert, im Gegenteil,
sie wurden ausgefahren. Ursprünglich hatten wir ja mal bei
Zucker in der EU einen Importbedarf, für viele Jahre waren
wir dann der weltgrößte Exporteur, jetzt sind wir der zweitgrößte.
Wir exportieren 5 bis 6 Millionen Tonnen Zucker mit Hilfe
von Quersubvensionen und Direktsubvensionen. Und das ist
das Hauptproblem, was man auch daran sieht, dass die Panelklage
bei der WTO von Brasilien, Thailand und Australien eben
nicht unseren Marktzugang attackierte, den geschlossenen
Marktzugang, sondern unsere Exportsubvension bzw. Exportmengen.
Deswegen, und da schließe ich mich auch Herrn Prof. Isermeyer
an, ist also das Primärproblem jetzt, was wir in Angriff
nehmen müssen, die Mengen abzusenken, im Gegensatz zu dem
Vorschlag der EU-Kommission, die die Preise sehr stark und
die Mengen nur ein wenig senken will. Vor allen Dingen,
weil wir sehr stark bezweifeln, ob die Preissenkung auch
anschließend zu der entsprechenden weiteren Mengensenkung
der C-Rüben führen wird, wie die EU das spekuliert. Aber
wir müssen nicht nur wegen der WTO-Klage unsere Mengen herunterfahren,
sondern es geht nicht an, dass wir ein Quotensystem im Inneren
und eine offene Flanke haben. Das kommt automatisch zu enormen
Widersprüchen und die EBA-Länder, also die LDC-Länder, die
von EBA profitieren, werden mit Sicherheit ihre Produktion
hochfahren und da sind viele darunter, die sehr profitabel
sind. Sie sind am Anfang des Ausbaus ihrer Zuckerindustrie
und können diese unter modernsten Bedingungen hochfahren.
Aber auch die Zukunft von Cotonou, also dem AKP-Abkommen,
gefährdet unsere Zuckermarktordnung, denn Sie wissen, dass
der waiver von Cotonou bei der WTO im Jahre 2009 ausläuft.
Dann soll der AKP-Vertrag überführt werden in Partnerschaftsverträge,
sog. Economic Partnership Agreements, welche regionale Freihandelszonen
zwischen der EU und den jeweiligen Regionen der Entwicklungsländer
etablieren werden, so dass also nicht nur nach 2009 die
LDCLänder freien Marktzugang bekommen, sondern im Rahmen
von diesen EBA-Abkommen auch Nicht- LDC-Länder. Das ganze
wird mengenmäßig unsere interne Zuckermarktordnung sprengen,
wenn wir nicht was Vernünftiges einführen. Das wäre für
mich zunächst einmal im Übergang auf jeden Fall ein Zollkontingentsystem
zusammen mit einer drastischen Senkung unserer eigenen Produktion
mit der gleichzeitigen Aufrechterhaltung der Quoten im Inneren,
denn auch die Landwirte hier bei uns werden durch die Mengensenkung
so stark geschädigt, dass Mengensenkung und Preissenkung
gleichzeitig kaum zu verkraften ist. Der andere Vorteil
einer starken Mengensenkung bei gleichzeitiger Zollkontingentierung
ist, dass wir damit die Probleme des freien Marktzuganges
unter EBA und EPA in den Griff bekommen und gleichzeitig
mit den Zollkontingenten, die ja hervorragende Anreize sind,
den ärmsten Entwicklungsländern besondere Vorteile einräumen
können, um ihre Zuckerproduktion so auszubauen, dass sie
sozial und ökologisch verträglich ist. D. h. nur Zollkontingente
und Umweltstandards kann man mit den Sozialstandards verbinden,
aber reiner Marktzugang oder Freihandel lässt sich nicht
damit verbinden und wäre auch WTO-inkonform. Deswegen, und
das ist die zweite große Chance mit Zollkontingenten, ist
das mit den Sozialstandards zu verbinden, wobei Sozialstandards
nicht nur in unserem Präferenzhandel mit diesen Entwicklungsländern
zum Zuge kommen sollen, sondern wir müssen uns auch gleichzeitig
für Sozialstandards im Grundsätzlichen im Zuckersektor einsetzen,
wenn wir glaubwürdig sein wollen. Das würde bedeuten, dass
wir z. B. beim internationalen Zuckerabkommen dort mit Verhandlungen
beginnen usw.. |
| |
Ich möchte zum Schluss noch kurz was zu AKP-Zucker sagen.
Wir sind der Meinung, dass die AKPQuoten falsch verteilt
sind. Es profitieren hauptsächlich reichere Entwicklungsländer
davon. Die LDC´s haben so gut wie keine Quoten, sie konservieren
überkommene Strukturen, die z. T. in diesen Ländern völlig
überaltet und ineffizient sind und haben dort auch zu der
Entstehung von Zuckerbaronen geführt. Wir sind dafür dieses
AKP-Abkommen mit dem waiver auslaufen zu lassen und stattdessen
überzuführen in Partnerschaftsabkommen im Rahmen von EBA,
die dann neu ausgehandelt werden müssten. Man kann das Zuckerabkommen
kündigen unter bestimmten Bedingungen, aber zwei Jahre im
vornherein, d. h. es müsste bald gekündigt werden nach Kapitel
10 des Chapter 5 des Cotonou-Abkommens. |
| |
Und nun zu länderspezifischen Aktionsprogrammen: |
| |
Wir sind ganz dagegen, Kompensation an die Entwicklungsländer
nach Flächenprämien zu zahlen. Unsere Forderung wäre, dass
die Gelder, die jetzt für den Reexport von AKP-Zucker ausgegeben
werden, auch in Zukunft der Entwicklung dieser Länder zur
Verfügung stehen, um ihnen und den LDC´s zu helfen, einen
vernünftigen Übergang ihrer eigenen Zuckerwirtschaft vorzunehmen,
so dass sie sich an die neueren doch freieren Handelsbedingungen
anpassen können.Dankeschön. |
| Video |
Dr. Hans-Jörg Gebhardt, Wirtschaftliche Vereinigung
Zucker, WVZ: |
| |
Vielen Dank Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. |
| |
Wir bedanken uns für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen
zu dürfen. Ich möchte anknüpfen an das, was Herr Prof. Isermeyer
gesagt hat. Im Grunde muss eine Zieldefinition, wohin wir
wollen im Zuckerbereich allem vorangestellt werden. Um diese
Zieldefinition machen zu können, muss man natürlich auch
die gegenwärtige Situation kennen, von der aus dann diese
Entwicklung zu neuen Zielen vonstatten gehen kann. Deshalb
ist die grundsätzliche Frage zu stellen, wie viel Prozent
des eigenen Zuckerbedarfs in Europa auch in eigener Produktion
zukünftig gedeckt werden soll. |
| |
Ich möchte Ihnen nochmals kurz einige Zahlen ins Gedächtnis
rufen, wie die Struktur der Zuckerwirtschaft in Deutschland
und Europa aussieht. Wir haben es in Deutschland mit 48.000
Betrieben mit Zuckerrübenanbau auf 450.000 Hektar mit einer
durchschnittlichen Anbaufläche von 9 ha pro Betrieb zu tun.
Es sind klassische Familienbetriebe so wie sie eigentlich
auch unsere Gesellschaft in Zukunft gerne haben möchte.
In den 26 Zuckerfabriken sind 6.300 Menschen beschäftigt,
20.000 Beschäftigte im vor- und nachgelagerten Bereich sind
rund um die Zuckerwirtschaft noch hinzuzuzählen. |
| |
In der neuen vergrößerten EU-25 sind 375.000 Betriebe
mit Rübenanbau auf einer Fläche von 2,2 Mio. ha befasst.
Die durchschnittliche Anbaufläche beträgt lediglich 5,5
ha. Wir haben 230 Zuckerfabriken im Moment unter Dampf und
im gesamten Sektor sind es 300.000 Beschäftigte. |
| |
Betriebe mit Rübenanbau, dass wurde auch in einigen Ausarbeitungen
im Vorfeld zu dieser Anhörung deutlich, insbesondere, wenn
sie einen relativ hohen Anteil an Rüben in ihrem Betrieb
haben, erwirtschaften aus diesem Sektor 50 % und mehr ihres
Einkommens. Es handelt sich bei diesen Betrieben, wie Sie
aus den Zahlen ja entnehmen konnten, um sog. bäuerliche
Familienbetriebe. |
| |
Die Zuckererzeugung in der EU ist seit vielen Jahren
konstant. D. h., die zusätzlichen Mengen, die wir auf dem
Weltmarkt sehen, kommen nicht aus Europa. Die Produktion
liegt bei 20 Mio. Tonnen insgesamt, das sind 13,6 % der
Welterzeugung. Die Nettoexporte der EU betragen bei einem
Verbrauch von rund 16 Mio. Tonnen damit ca. 4 Mio. Tonnen.
Sie gehen vor allem in den Nahen und Mittleren Osten. Lassen
Sie mich einen Vergleich machen: |
| |
Brasilien erzeugt 22 Mio. Tonnen Zucker, Brasilien verbraucht
weniger als die Hälfte, nämlich nur 9 Mio. Tonnen und exportiert
mit wachsenden Raten im Moment mehr als 12 Mio. Tonnen.
Brasilien hat seine Exporte innerhalb von drei Jahren von
2000 bis 2002 verdoppelt, in den letzten zehn Jahren sogar
versechsfacht. |
| |
Es wurde auch etwas zum Zuckerweltmarkt und zur Marktordnung
gesagt. Der Weltmarkt ist geprägt durch strukturelle Überschüsse.
Wir haben es hier mit einem Restemarkt zu tun. Er wird im
Wesentlichen bestimmt durch brasilianischen Zucker, der
dann auch mit der Ethanolproduktion, je nach Lage der Preise
auf den Weltmärkten, hin und her geswitcht werden kann.
Prof. Isermeyer hat das gesagt. Der Anteil der EU an den
weltweiten Exporten liegt bei rund 10 %. Der Anteil der
EU an den weltweiten Importen liegt bei rund 5 %. Der EU-Anteil
an der Welterzeugung beträgt knapp 14 %. |
| |
Was bedingt unsere Marktordnung oder warum haben wir
sie und warum brauchen wir sie? Die europäischen Produktionskosten
werden insbesondere sehr stark bestimmt durch unsere hohen
europäischen Umwelt- und Sozialstandards. Eine nachhaltige
Produktion von Rüben und Zucker, sie müsste noch ausgefüllt
werden, man kann das in der Diskussion ja ausführen, ist
in der EU zu Weltmarktpreisen damit nicht möglich. Die Marktordnung
sichert nachhaltige Produktionen in Europa. |
| |
Die Marktordnung hat ferner wichtige entwicklungspolitische
Funktionen, Herr Buntzel-Cano hat zumindest in einigen Bereichen
darauf schon Bezug genommen. |
| |
Die Reformnotwendigkeiten wurden von Herrn Prof. Isermeyer
sehr deutlich analysiert. Es sind insbesondere die externen
Faktoren, WTO-Panel, EBA und LDC-Initiative, die eine Reform
unausweichlich scheinen lassen. Der Abbau bzw. die langfristig
auslaufenden Exporte werden von uns als notgedrungen akzeptierbar
gesehen. Auch eine Reduzierung des Außenschutzes wird notgedrungen
zu Preissenkungen führen. Was wir brauchen, ist den Status
des sensiblen Erzeugnisses für Zucker und trotzdem werden
Preissenkungen nicht ausbleiben können. Neue Verpflichtungen
werden dann voraussichtlich frühestens 2007 wirksam und
deshalb sind wir der Meinung, dass der Kommissionsvorschlag
und dessen Umsetzung vor allen Dingen das Vorhaben, das
bereits nächstes Jahr zu tun, wesentlich verfrüht kommen,
weil wir die Ergebnisse der externen Faktoren nicht in Gänze
kennen. Bei negativem Ausgang des Panels, über das wir schon
gesprochen haben, werden rund 4,5 Mio. Tonnen Zuckererzeugung
der EU gefährdet werden, weil auch die 1,6 Mio. Tonnen Präferenzzucker
im Focus dieses Panels stehen. Das ist schlechtweg ein Viertel
der aktuellen europäischen Produktion. |
| |
Zur EBA-Initiative: |
| |
Auch hier wissen wir, dass die wachsende Zahl der Entwicklungsländer
sieht, dass sie auf Grund der Produktionskosten in ihren
Ländern nicht in der Lage sein werden, ihre Zuckerwirtschaft
weiter zu entwickeln. Deshalb unterstützen wir das Ansinnen,
die LDC-Länder wie die AKP´s in eine Mengenregelung einzubinden.
Wir gehen davon aus, dass dies eine sehr wichtige Position
auch in der Veränderung des Kommissionsvorschlags sein wird. |
| |
Wenn man die drei externen Faktoren zusammenfasst, WTO,
Panel und EBA, dann können diese zu Produktionseinschränkungen
in der EU von bis zu 8 Mio. Tonnen und damit 40 % der aktuellen
Produktion führen. Die wesentlichen Inhalte der Reformvorschläge
kennen Sie. Sie würden nach unserer Einschätzung negativ
auf die EU-Produzenten wirken, selbstverständlich aber auch
auf die AKP- und die LDC-Länder. Sie würden negative Aspekte
für die Umwelt und insbesondere auch für den EU-Haushalt
mit sich bringen. Die drohenden Mengen- und Preiswirkungen
gefährden zahlreiche Existenzen und Arbeitsplätze und die
starken Preissenkungen, auch das hat der Herr Prof. Isermeyer
gesagt, tragen nicht dazu bei, ein Gleichgewicht auf dem
europäischen Markt herbeizuführen, denn dieses Gleichgewicht
wird sich erst bei einem wesentlich niedrigeren Preis als
bei 421,- Euro die Tonne Zucker einpendeln und dann wäre
die EU-Produktion total am Ende. |
| |
Zum Thema WTO, Einstufung von Zucker als sensibles Erzeugnis
und Akzeptanz der daraus resultierenden Preissenkung. Akzeptanz
einer Rückführung der gestützten Exporte. Beim Panel: |
| |
Bei negativem Ausgang Neuverhandlung der gestützten Exportmenge
im Rahmen der Doha-Runde. EBA: Einbindung des Mengenmanagements
der ZMO, Verbot des SWAP, d. h. von Tauschgeschäften und
eine strenge Ursprungsdefinition. Bei der Reform der Marktordnung
Preissenkung nur entsprechend den externen Notwendigkeiten,
eine Reduzierung der Quoten im unvermeidbaren Umfang, nach
Möglichkeit zunächst freiwillig mit entsprechenden Anreizen
unterlegt und schließlich eine EUeinheitliche Gestaltung
der Ausgleichszahlung zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen.Vielen
Dank. |
| Video |
Penny Fowler, OXFAM International: |
| |
Es tut mir leid, dass ich hier auf Englisch sprechen
muss, aber vielen Dank, dass Sie es mir nachsehen, dass
Sie sich an die OXFAM halten, als eine internationale Entwicklungsorganisation.
Es ist natürlich nicht überraschend, das unser Hauptaugenmerk
als OXFAM, wenn es um die momentane Diskussion der EU-Reform
der Zuckerordnung geht, auf den armen Ländern der Welt liegt.
Das ist natürlich unser Hauptanliegen und im Moment besorgt
uns bei der gesamten Diskussion dieses Themas sehr, dass
im Zusammenhang mit dem zukünftigen Kurs der Europäischen
Union nach unserer Ansicht nicht genügend berücksichtigt
wurde, welche Rolle die armen Länder hier spielen. Das ist
natürlich verständlich auf Grund der verschiedenen Besitzstände
und der verschiedenen nationalen Lagen, die hier berücksichtigt
werden müssen, aber ich würde es trotzdem sehr begrüßen,
wenn die entwicklungspolitische Dimension ebenfalls berücksichtigt
würde. |
| |
Zuerst einmal aus ethisch-moralischer Sicht, denn wenn
die Entwicklungspolitik von der Zuckerordnungsreform profitieren
könnte, könnte das in großer Weise dazu beitragen, dass
hier auch wirklich in den Entwicklungsländern Fortschritt
erzielt wird. Tausende von Leuten haben ja in diesen Ländern
keinen Zugang zu Wasser und deswegen ist es doch durchaus
notwendig, dass auch ihre Bedenken berücksichtigt werden.
Natürlich gibt es auch ein berechtigtes Eigeninteresse an
dieser Diskussion. Wir alle erkennen an, dass es auch Vorteile
gibt, wenn wir hier entwicklungspolitische Durchbrüche bei
den WTO-Verhandlungen erreichen würden und auch die Zuckerreform
könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten, um ein Umfeld
zu schaffen, in dem die WTO ihre Verhandlungen früher und
erfolgreicher abschließen kann. |
| |
Jetzt möchte ich aus OXFAM-Sicht auf die drei Hauptpunkte
zu sprechen kommen. Zuerst einmal sind uns die Exportwirkungen
der europäischen Zuckermarktpolitik sehr wichtig. Exportdumping,
d. h. Preise unter den Produktionskosten, die unserer Meinung
nach den Wettbewerb verzerren für andere wettbewerbsfähige
Zuckerproduzenten auf der weltweiten Ebene muss im Rahmen
des Panels der WTO, der bereits angesprochen wurde, angegangen
werden. Es gibt Außendruck, das ist einer unserer Punkte. |
| |
Der zweite Punkt ist der Marktzugang für die am wenigsten
entwickelten Länder der Welt, die LDC´s. |
| |
In einigen dieser Länder ist Zucker sehr wichtig, wenn
es darum geht, den Leuten eine Gelegenheit zu geben, ihren
Lebensunterhalt zu verdienen, denn sie haben nicht viele
andere Einkommensquellen. |
| |
Das ist natürlich sehr wichtig. Wir haben vor kurzem
eine Forschung in Mocambique und Sambia durchgeführt und
haben geschätzt, dass hier allein in Mocambique und Sambia
im Zusammenhang mit der Entwicklungspolitik 30.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, wenn die Zuckerreform
der EU erfolgreich sein würde. Für diese Länder machen diese
30.000 Arbeitsplätze wirklich einen riesigen Unterschied.
Diese Länder wollen einen längeren Übergangszeitraum haben,
so dass sie investieren, ihre Produktivität ausbauen, ihre
Wettbewerbsfähigkeit steigern und auch dafür sorgen können,
einen sozialen und sozialnachhaltigen Zuckersektor zu entwickeln.
Wir unterstützen diese Länder hier bei ihrem Anliegen, dass
sie hier mehr Übergangszeitraum brauchen, um mehr Investitionen
in den Zuckermarktsektor anzuziehen. |
| |
Unser dritter Punkt betrifft die AKP-Staaten und die
LDC´s. Einige dieser Staaten können auch weiterhin Zucker
in einem wettbewerbsintensiveren Umfeld produzieren, aber
einige von ihnen werden auf der Strecke bleiben, weil ihre
Kosten zu hoch sind. Und wir müssen großes Augenmerk darauf
richten, dass wir hier gemeinsam mit ihnen Maßnahmen entwickeln,
die Auswirkungen der EUZuckermarktreform anzugehen. Diese
Maßnahmen müssen greifen, bevor die Reformen eingeführt
werden, damit diese Staaten auch wirklich die Möglichkeit
haben, entweder zu investieren und die Wettbewerbsfähigkeit
ihrer Branchen zu steigern oder aber Alternativen zu finden,
um zu diversifizieren, z. B. die Produktion zu verlegen,
weg vom Zucker hin zu Gebieten, wo sie auch eine nachhaltige
Zukunft erwarten. |
| |
Nachdem ich dies voraus geschickt habe, möchte ich noch
einmal kurz zusammenfassen: |
| |
Wir sind davon überzeugt, dass diese drei Hauptpunkte
aus entwicklungspolitischer Sicht von wichtiger Bedeutung
sind. Sie erhalten jedoch nicht genug Stellenwert. Man braucht
einen AKP-Aktionsplan. Es gibt verschiedene Maßnahmen, aber
wenn man mit den AKP-Staaten alleine redet, ist das nicht
genug. Man muss einen Dialog entwickeln, um hier auf einzelstaatlicher
Ebene einzelne Maßnahmenkataloge zu entwickeln, die die
Bedürfnisse vor Ort angehen. Die LDCs sind auch sehr wichtig.
Die Preise sind nicht ausreichend berücksichtigt worden
in diesen am wenigsten entwickelten Staaten und deswegen
kann es vielleicht auch zu Gefahren für einen nachhaltigen
Zuckersektor kommen. Die Reformvorschläge der Europäischen
Union im Zusammenhang mit Preissenkungen und den begrenzten
Senkungen bei den Quoten werden das Exportdumping nicht
beenden, was für uns ja ein großer Bedenkenpunkt ist. Das
waren die drei Hauptaspekte, die ich ansprechen wollte in
diesem Rahmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. |
| Video |
Markus Dietrich, Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten,
NGG: |
| |
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zur Anhörung
und für die Gelegenheit, den umfangreichen Fragenkatalog
beantworten zu können. Ich möchte jetzt die Stellungnahme
nicht mehr detailliert wiedergeben. Es wird deshalb das
eine oder andere Argument plakativ sein, ich bitte dafür
um Verständnis. |
| |
Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten lehnt die
von der Kommission unterbreiteten Vorschläge in der Form
ab. Sie lassen gewisse Details und Faktoren unberücksichtigt.
Ein Teil wurde schon erwähnt, ich will es nur kurz wiederholen.
Es ist unberücksichtigt der Preis- und Mengendruck durch
zusätzliche Einfuhrströme und sinkende Ausfuhrmöglichkeiten,
Stichwort WTO-Panel und WTOVerpflichtungen bzw. die eingegangenen
Verpflichtungen im Rahmen der Entwicklungshilfe für AKP-Länder.
Unberücksichtigt ist unserer Meinung nach auch die Tatsache,
dass im Zuckersektor weltweit nicht die Marktkräfte wirken,
nicht der Preis über Angebot und Nachfrage bestimmt wird,
sondern öffentliche Interventionen den Zuckerpreis beeinflussen.
Wir halten deshalb einen Vorgriff vor WTOMaßnahmen für überzogen,
das wäre falsch. Unberücksichtigt bleiben die sozialen und
ökologischen Mindeststandards, die in einer Reihe von Entwicklungsländern
nicht beachtet werden. Es sind ja nicht nur das Überangebot
oder die klimatischen und die Bodenverhältnisse, die den
Preis bilden, sondern eben auch soziale und ökologische
Mindeststandards, die in Europa berücksichtigt werden und
deshalb zu einem höheren Preis führen. Dies wurde bereits
erwähnt. Wir teilen auch nicht die Philosophie, dass ein
Freihandel grundsätzlich ökonomische Rückständigkeit beseitigen
wird. Er lässt einfach die spezifische Situation in den
Entwicklungsländern unberücksichtigt. Diese Philosophie
missachtet auch die ungleichen Austauschverhältnisse, die
terms of trade. Wir halten eine Kopplung oder die Forderung,
dass man die Zuckermarktordnung ändert, auf Grund dieser
Philosophie „Freihandel fördert Entwicklung“ für falsch.
Es wurde bereits zu Recht erwähnt, dass die Vorschläge zur
Folge hätten, dass auch die jetzigen Entwicklungsländer,
die im Sinne einer Entwicklungshilfe durch den begünstigten
Handel gefördert werden, eine Reihe davon auf Grund der
Produktionskosten, ihren Handel mit Europa einstellen müssten.
Die Entwicklungshilfe würde somit konterkariert. Wir sehen,
dass die bisherige Regelung, insbesondere die gestützten
Preise, den zuckerverarbeitenden Betrieben gleiche Wettbewerbsbedingungen
und gleiche Ausgangsbedingungen gewährleisten. |
| |
Würden die EU-Vorschläge umgesetzt, würde der Spielraum
für Preisverhandlungen steigen und die Gefahr besteht, dass
große abnehmende zuckerverarbeitende Betriebe sich auf Grund
von Mengenrabatten gewisse Preisnachlässe aushandeln können
und das kleine und mittlere zuckerverarbeitende Betriebe
dann auf der Strecke bleiben, also mit anderen Worten, eine
gewisse Wettbewerbsverzerrung entstehen wird, die dann natürlich
auch in der zweiten Runde Arbeitsplätze im Bereich der zuckerverarbeitenden
Sektoren gefährden wird. |
| |
Darüber hinaus würden die Vorschläge natürlich zu Einkommenseinbußen
in der Landwirtschaft führen. Wir haben es schriftlich dargestellt,
dass die Chancen für die Landwirtschaft auf ein zweites
Standbein, auf weitere Agrarkulturen umzusteigen schwierig
sind und wir haben darauf hingewiesen, dass es zu Arbeitsplatzverlusten
kommen wird. Wir bitten zu beachten, dass sowohl direkt
als auch indirekt Arbeitsplätze betroffen sind. Die Gefahr
besteht, dass ländliche strukturschwache Räume wirtschaftlich
veröden und man wird dann im Grunde genommen dreißig Jahre
regionaler Wirtschaftspolitik konterkarieren. Die erhoffte
Haushaltsentlastung der Gebietskörperschaften wird nicht
eintreten. Ich sagte schon, dass es bei einer Umsetzung
zu Arbeitslosigkeit, zu Einkommenseinbußen kommen wird.
D. h. mit andern Worten, dass die erhofften Einsparungen
durch die Maßnahmen nach unseren Berechnungen bei weitem
durch zusätzliche Ausgaben in Form von Ausgleichszahlungen
und Ersatzleistungen überkompensiert werden, aber eben auch
Mindereinnahmen der Sozialversicherungskassen auftreten
werden. Kurzum, wir glauben, dass die bisherige Regelung
dazu geführt hat, dass wir damit leben können. Wir halten
es auch nicht für legitim, dass man die Stellschrauben so
ansetzt, dass man den Eigenverbrauch senkt. Uns ist kein
Wirtschaftszweig in der Bundesrepublik, auch nicht im Agrarsektor,
bekannt, dem zugemutet wird, unter dem Eigenverbrauch zu
produzieren.Vielen Dank. |
| Video |
Dietrich Oetzel, InfoZentrumZuckerverwender, IZZ: |
| |
Vielen Dank Frau Vorsitzende. Vielen Dank meine Damen
und Herren, dass wir heute die Gelegenheit haben, ebenfalls
hier zu Ihnen zu sprechen. Bisher haben wir sehr viel gehört,
was gegen eine Reform spricht. Natürlich möchten wir kurz
darstellen, was an Argumenten für eine Zuckermarktreform
spricht. Ich spreche hier im Auftrag des IZZ und wir sind
ein Zusammenschluss der Hersteller alkoholfreier Getränke,
der Süßwarenindustrie, der Obst, Gemüse und Kartoffel verarbeitenden
Industrien sowie der Großbäckereien hier in Deutschland.
Die zuckerverarbeitende Wirtschaft in Deutschland bietet
rund 400.000 Menschen Beschäftigung. Das gegenüber den Zahlen,
die wir zum Teil schon gehört haben, 2.000 Beschäftige im
zuckerherstellenden Bereich plus natürlich unsere Landwirte,
die in diesem Bereich tätig sind. Demgegenüber haben wir
ein vielfaches davon in der zuckerverarbeitenden Industrie,
nämlich 400.000 Menschen. Im Jahr 2003 sind aus diesen Industriebereichen
rund 40 Milliarden Euro erwirtschaftet worden, dass sind
etwa 2 % des deutschen Bruttosozialproduktes. Wir hören
so häufig, dass ja diese Befürworter der Zuckermarktreform
das eigentlich nur tun, um Coca Cola zu unterstützen. Ich
möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass wir
es mit einer großen Anzahl von kleinen und mittleren Unternehmen
zu tun haben und das diese Unternehmen, wie die gesamte
Branche rund 80 % des in Deutschland konsumierten Zuckers
verarbeitet und das in der deutschen zuckerverarbeitenden
Industrie rund 62 mal mehr Menschen arbeiten als in der
Zuckerindustrie. Zucker ist natürlich für uns und unsere
Unternehmen einer der wichtigsten Rohstoffe und aus diesem
Grund brauchen wir nach wie vor leistungsfähige Lieferanten
für diesen Rohstoff. |
| |
Allerdings stehen wir als Verarbeitungsindustrien mit
unseren Produkten im globalen Wettbewerb. |
| |
Beim Rohstoff Zucker hingegen sind wir seit Jahrzehnten
mit einer planwirtschaftlichen Marktordnung konfrontiert,
und wir sehen einen eklatanten Mangel an Wettbewerb. |
| |
Wir sehen nunmehr seit 37 Jahren die verfehlte Zuckerpolitik
der Europäischen Union als Ursache für die Bildung regionaler
Monopole, das habe ich eben schon erwähnt, einen drastisch
überhöhten Zuckerpreis, der - und das sind nicht unsere
Berechnungen – die europäischen Verbraucher nach Angaben
des Europäischen Rechnungshofes rund 6,5 Milliarden Euro
pro Jahr kostet. Natürlich um fair zu bleiben in der Argumentation,
ist das ein Vergleich zu Weltmarktpreisen, aber dennoch
– Sie alle wissen, der Weltmarktpreis liegt zur Zeit um
die 200,- Euro oder 200,- US Dollar pro Tonne. Selbst wenn
wir das auf den jetzt angestrebten Preis von 421,- Euro
reduzieren, bleiben noch einige Milliarden an Kosten über. |
| |
Wir wissen auch, dass diese Zuckerpolitik eine Behinderung
und Verzerrung des Welthandels gebracht hat, nicht ohne
Grund haben wir zurzeit das WTO-Panel, und last not least,
dass jahrzehntelang eigentlich ein Innovationsstillstand
und eine mangelnde Weiterentwicklung im Bereich der natürlichen
Süßungsmittel stattgefunden hat. |
| |
Die jetzige Zuckermarktordnung stellt natürlich unsere
Unternehmen vor erhebliche Probleme. |
| |
Überhöhte Rohstoffkosten von Zucker sind vor allem für
exportorientierte Unternehmen ein gravierender Standortnachteil.
Unsere Produkte stehen national in Konkurrenz zu Erzeugnissen
mit |
| |
geringem Zuckeranteil und international im Wettbewerb
zu allen exportfähigen Lebensmitteln und vor allem zu Erzeugnissen
von Unternehmen, die Zucker preiswert auf dem Weltmarkt
einkaufen können. |
| |
In den letzten 37 Jahren haben sich nicht nur die Anforderungen
an unsere Unternehmen, sondern auch an die Agrarwirtschaft
geändert, nur allein die Zuckermarktordnung ist noch unreformiert
und stellt mehr denn je einen Fremdkörper in einem modernen
Wirtschaftsgefüge und in einer ansonsten reformierten Europäischen
Agrarpolitik dar. Das ist also der einzige Sektor, den es
noch zu reformieren gilt. Und dies gilt insbesondere vor
dem Hintergrund, dass die Zuckermarktordnung als einzige
Marktordnung nicht nur die landwirtschaftliche Produktion,
sondern auch die nachgelagerte Zuckerindustrie in ihren
Schutz einbezieht. Das ist einmalig. Diese Probleme hat
natürlich auch die EU-Kommission erkannt und das IZZ begrüßt
deshalb die von der EU-Kommission vorgelegten Vorschläge.
Das Eckpunktpapier betrachten wir als einen Schritt in die
richtige Richtung. Allerdings sollten danach zügig weitere
Reformen folgen, um Wettbewerb im Zuckersektor einzuführen,
internationale Verpflichtungen zu erfüllen und auch die
teure Überproduktion entsprechend einzudämmen. Diese Ziele
werden mit dem Eckpunktpapier der Kommission nämlich nur
teilweise erreicht. |
| |
Insbesondere ist die geplante Aufrechterhaltung des Quotensystems
problematisch, weil es bei den starren Marktstrukturen und
einer deutlichen Überproduktion bleiben wird. Um die Zuckerproduktion
auch langfristig an den am besten geeigneten Standorten
der EU wettbewerbsfähig zu erhalten, muss das rigide Quotensystem
mittelfristig auslaufen. Und Deutschland hat sicherlich
neben Frankreich die besten Chancen, Quoten entsprechend
auf sich zu ziehen und dort wettbewerbsfähig zu bleiben. |
| |
Eine Reform der EU-Zuckermarktordnung ist vor allem im
Hinblick auf WTO-Verpflichtungen unerlässlich geworden,
denn die WTO fordert eine Abkehr von Agrarprotektionismus
durch Zollsenkungen und besseren Marktzugang für Erzeugnisse
aus Entwicklungsländern. Der Reformdruck erhöht sich noch
durch ein von Brasilien, Thailand, Australien usw. angestrengtes
WTO-Panel – wir werden da sicherlich noch ausführlicher
darüber sprechen und auch von dort gibt es entsprechenden
Druck. |
| |
Zeitlich haben wir sicherlich alle ein Problem. Die Zuckermarktordnung,
wie wir alle wissen, läuft in 2006 aus. Wir alle wollen,
und ich glaube zumindest in dem Punkt sind alle Vertreter
der verschiedenen Parteien und Interessensparteien einig,
mehr Planungssicherheit, d. h. wir müssen zügig zu entsprechenden
Entscheidungen kommen, damit alle Beteiligten wissen, woran
wir sind. Wir sind der Meinung, dass Deutschland bei einer
entsprechenden Umsetzung der von der Kommission vorgeschlagenen
Maßnahmen zu den Profiteuren zählen würde. Denn ich sagte
es eben schon, dass neben Frankreich Deutschland über die
besten Böden für den Rübenanbau verfügt und die deutsche
Zuckerindustrie hoch profitabel arbeitet. Durch die geplante
grenzüberschreitende Handelbarkeit der Quote könnten Produktionsrechte
aus anderen Staaten hinzugekauft werden. Dies ist vor allem
für die deutsche Zuckerwirtschaft interessant, da hier der
C-Zucker-Anteil sehr hoch ist. Durch die geplanten Ausgleichszahlungen
in Höhe von etwa 60 % der Erlösminderungen ergibt sich die
Möglichkeit zum Anbau alternativer Kulturen und mit der
Zahlung der bereits ab 2005 für die Rübenflächenvorgesehenen
Flächenprämien würden die Reformmaßnahmen für die Rübenbauern
weitgehend einkommensneutral bleiben. |
| |
Ich darf zusammenfassen:
Wir sind der Meinung, dass es für die Zuckermarktreformvorschläge
eigentlich nur Gewinner geben sollte, dass die Rübenanbauer
und die Zuckerindustrie durch den Quotenhandel zumindest
die Produktion auf dem heutigen Niveau halten könnte, dass
die zuckerverarbeitende Industrie wettbewerbsfähig bliebe
und die Arbeitsplätze in Deutschland gesichert bleiben,
dass die Europäische Union ihren internationalen Verpflichtungen
nachkommen kann und last not least, dass auch der Verbraucher
letztendlich entsprechend entlastet wird und da spreche
ich also nicht nur von dem sog. Haushaltszucker, sondern
auch in Form der verarbeiteten Produkte. Es ist also Zeit,
die Reform anzugehen. Vielen Dank für das erste Zuhören
und das erste Statement. |
| Video |
Christian Bär, Deutscher Bauernverband, DBV: |
| |
Zunächst vielen Dank Frau Vorsitzende. Meine sehr geehrten
Damen und Herren. Auch ich danke für die Möglichkeit, heute
hier im Rahmen dieser Anhörung die Position des Deutschen
Bauernverbandes einmal vortragen zu können. Die anstehenden
Reformen zur Zuckermarktordnung sind ein außergewöhnlich
komplexes Thema. Ich denke, dass hat der Ausschuss auch
mit seinen zu dieser Anhörung gestellten Fragen deutlich
gemacht. Wir haben darauf geantwortet und ich möchte in
den einzelnen Punkten dies nicht aufgreifen, sondern lassen
Sie mich einige wesentliche Problempunkte hier noch einmal
ansprechen, um die Gleichheit auch dessen herbeizuführen,
was heute Morgen hier vorgetragen worden ist. |
| |
Wir wissen, die Reform der Marktordnung ist notwendig.
Internationale Verpflichtungen machen eine Anpassung der
europäischen Zuckerpolitik an veränderte handelspolitische
Rahmenbedingungen erforderlich. Mit ihren Vorschlägen vom
14. Juli 2004 für die Reform dieser Zuckermarktordnung geht
die EU-Kommission allerdings nach unserer Auffassung weit
über die tatsächlichen Reformnotwendigkeiten hinaus. Wir
sind bereit, konstruktiv an den notwendigen Reformmaßnahmen
mitzuarbeiten, erwarten dazu jedoch auch realistischere
Vorschläge. |
| |
Zum einen zum Beginn und zur Dauer dieser Reformperiode.
Nach unserer Auffassung kann eine Reform frühestens ab dem
Zuckerwirtschaftsjahr 2006/2007 in Betracht kommen. Weiterhin
wichtig ist, dass sich die Laufzeit der nächsten Zuckermarktordnung
wegen der notwendigen Investitions- und Planungssicherheit
an den neuen WTO-Verpflichtungen orientieren muss. Insbesondere
für die bäuerlichen Betriebe muss dies mindestens bis 2012
festgeschrieben werden. |
| |
Es ist sehr viel heute Morgen schon über Preissenkungen
gesprochen worden. Wir meinen, die Reduzierung des gemeinschaftlichen
Preisniveaus kann nur in dem Umfang und zu dem Zeitpunkt
erfolgen, indem dies insbesondere durch neue WTO-Verpflichtungen
erforderlich wird. Es ist heute Morgen auch schon darauf
hingewiesen worden, dass die Fortsetzung der Preispolitik
auch den europäischen Rübenanbauern die Chance geben muss,
zu ihren Produktionskosten im Sinne auch der sozialen und
ökologischen Standards zu produzieren. Wir sehen dies in
Solidarität auch zu den Berufskollegen, die z. B. in den
AKP-Ländern Zucker produzieren und damit auch auf unser
Preisniveau spekulieren. |
| |
Zur Vermeidung unnötiger Härten dürfen Preissenkungen
nicht im Vorgriff vorgenommen werden, sondern müssen parallel
zu den WTO-Verhandlungen laufen. Die vorgeschlagene 2. Stufe
der Preissenkung ist für uns indiskutabel. Es wurde heute
Morgen schon zur Frage der Zuckerquoten gesprochen. Die
hier beabsichtigte Fortsetzung der Mengenregulierung durch
Produktionsquoten wird auch von uns grundsätzlich positiv
beurteilt. Die Quotensenkung darf aber nicht die 1,3 Mio.
Tonnen überschreiten. Zusammen mit den durch das Panel in
Frage stehenden Erzeugungsmöglichkeiten von C-Zucker hat
bereits eine derartige Quotenreduzierung eine Verkürzung
der europäischen Zuckerproduktion um rund 21 % zur Folge
mit den daraus resultierenden Folgewirkungen auch für den
Anbau und die Zuckerwirtschaft. Ich mache kein Hehl daraus,
dass deutsche Rübenanbauer darauf angewiesen sind, eine
leistungsfähige Zuckerindustrie hinter sich zu haben. Das
ist ein Paket, was letztendlich zur Chancengleichheit führen
wird. |
| |
Völlig unverständlich ist die Anhebung der Isoglucosequote
um 300.000 Tonnen. Quotenkürzungen müssen nach unserer Auffassung
auch hier für Isoglucose gelten. Zu dem Bereich der Ausgleichsmaßnahmen
denke ich, dass es notwendig ist, die tatsächlichen Erlöseinbußen
der Rübenanbauer aus Preis- und Mengenreduzierungen gerecht
zu verteilen und letztendlich, das der Preisausgleich auch
bei den Rübenanbauern auch dauerhaft ankommt. Diese Ausgleichsregelung
muss betriebsindividuell bis mindestens 2013 vorgesehen
werden. |
| |
So viel meine Damen und Herren zunächst als Eingangsstatement
zu unserem Anliegen. Lassen Sie mich schließen mit dem Wunsch,
dass ich möglichst viele, insbesondere der Damen und Herren
Abgeordnete, bei dem am 10. November in Berlin stattfindenden
Forum Existenzfrage Zucker begrüßen darf.
Herzlichen Dank. |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Das ist ja nun gerade während unserer Ausschusssitzung.
Das liegt ja nicht am mangelnden Interesse. Vielen Dank. |
| Video |
Henning Koch, Firma August Töpfer: |
| |
Frau Vorsitzende, mit Ihrer Erlaubnis würde ich jetzt
gerne unser Statement abgeben. Mein Name ist Hennig Koch.
Ich arbeite seit 30 Jahren bei August Töpfer. |
| |
Wir sind hier in diesen Kreis glaube ich eingeladen worden,
um eine Sicht der Dinge aus der Perspektive des Handels
zu geben. So ist es auch bei den Vorgesprächen, die ich
geführt habe, deutlich geworden. Erlauben Sie mir deshalb
eine kleine Standortbestimmung und dann würde ich gerne
eine Bemerkung machen zu einem Komplex, der hier immer wieder
angesprochen wird, aber meiner Meinung nach falsch verstanden
wird. Ich meine damit den Begriff des Weltmarktes. Es wird
damit immer wieder umgegangen und wir haben ganz bestimmte
– wie soll ich sagen – Kenntnisse des Weltmarktes, die meiner
Meinung nach erläutert werden müssen. Und zuletzt möchte
ich nur eine kleine Bemerkung machen zu einem Detail des
Fragebogens, wo vom Exportdumping gesprochen wird. Ich fange
also an mit einer Standortbestimmung. |
| |
Wir sind Teil der im Zuckerhandel tätigen Firmen. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte haben wir bedeutende und umfangreiche
Netzwerke in logistischer, infrastruktureller und natürlich
auch in personeller Hinsicht geschaffen, um die EU-Zuckerüberschüsse
in eine Vielzahl von weltweiten Märkten zu exportieren.
Insbesondere in Weißzuckerimportländern, mit hoch entwickelter
Verarbeitungsindustrie und anspruchsvoller Kundschaft spielt
Zucker aus der EU eine beherrschende Rolle. Ein Wegfall
der Exporte, wie sie von der Reform der ZMO angestrebt wird,
würde dem europäischen Handel seine bisherige unmittelbare
Aufgabe entziehen, Verluste von Arbeitsplätzen wären unumgänglich,
aber auch bedeutende Investitionen, wie z. B. die weitgehend
vom Handel finanzierten und betriebenen Hafenterminals,
in denen loser Zucker abgesackt und in Schiffe und Container
verladen wird, würden überflüssig. |
| |
Auch Importe von auf EU-Zucker spezialisierte Länder,
exemplarisch wären hier Israel und die Schweiz zu nennen,
würden ihre gewohnte logistisch und qualitativ in Jahrzehnten
eingespielte Lieferbasis verlieren. Natürlich wird sich
der Handel bemühen, im Rahmen der angedachten Importe von
Zucker in die EU Aufgaben zu übernehmen. In welchem Maße
dies gelingen wird, kann allerdings erst dann beurteilt
werden, wenn sich die Einzelheiten der neuen Regelung und
die jeweilige Reaktion der Beteiligten heraus zu kristallisieren
beginnen. So viel nur zu unserer Rolle. Dann zum Weltmarkt,
der hier immer wieder angesprochen wurde. Einige Bemerkungen
müssen richtig gestellt werden. |
| |
Schon die Bezeichnung Weltmarkt ist unserer Meinung nach
sehr irreführend. Nach den gegenwärtigen Schätzungen werden
bald weltweit aktuell zwischen 145 und 148 Mio. Tonnen,
das ist ein Rohwert, produziert und, so sieht es jedenfalls
aus, in letzter Zeit auch konsumiert. Diese Menge wird auch
zu Weltmarktpreisen konsumiert werden. Zu freien ohne jegliche
Regulierung allein von Angebot und Nachfrage bestimmten
Konditionen wird dagegen nur ein vergleichsweise geringer
Teil der globalen Menge gehandelt, nämlich rund 45 Mio.
Tonnen, also etwa 30 %. Man kann das im Übrigen auch anders
rechnen und kommt dann auf einen Weltmarktanteil von nur
35 Mio. Tonnen. |
| |
Der Weltmarkt ist also eine Art Restemarkt, auf dem Produzenten
ihre Überschüsse abladen und Importländer ihren Bedarf,
der nicht durch Eigenproduktion gedeckt wird, besorgen.
Dies hat aber zur Folge, dass selbst im weltweiten Maßstab
geringfügige Produktions- oder Verbrauchsschwankungen, wie
sie z. B. auf Grund klimatischer Einflüsse bei der Produktion
oder konjunktureller Einflüsse beim Verbrauch einfach immer
wieder vorkommen, sich in diesem Restemarkt überproportional
manifestieren und auf die sich hier heraus bildenden Preise
auswirken. Zum Beispiel würde ein weltweiter Überschuss
von Produktion über Verbrauch von sagen wir mal 2 %, also
etwa 3 Mio. Tonnen, auf dem Weltmarkt zu einem Überschuss
von Angebot über Nachfrage von fast 7 % führen. |
| |
Entsprechendes gilt auch für ein Defizit. Dies hat in
den vergangenen Jahren immer wieder zu extremen, teilweise
geradezu absurden Preisausschlägen nach oben oder nach unten
geführt. Wie z. B. in den frühen 60er Jahren, als es zu
Notierungen für Rohzucker von knapp 1 US Cent pro Pound,
das sind 45,36 kg, 1974 von 64 Cents, und dann 1981 noch
mal bis zu 44 Cents pro Pound kam. |
| |
Beides liegt über dem damaligen EU-Niveau. Es versteht
sich beinahe von selbst, dass ein solcher Markt ein gefundenes
Fressen für internationale Spekulationen ist, so dass fundamental
begründete Preisausschläge immer wieder grotesk verzerrt
werden. |
| |
In den letzten Jahrzehnten, das ist unbestreitbar, sind
auf diesem so definierten Weltmarkt die Preise aber meist
niedrig gewesen, deutlich niedriger als die EU-Preise, auch
niedriger als das Inlandspreisniveau der meisten anderen
Anbieter. Nun verkauft niemand, auch die EU selbstverständlich
nicht, seine Exporte absichtlich mit Verlust. Die weltweite
Produktion hat aber in den vergangenen Jahren den weltweiten
Konsum mit einiger Regelmäßigkeit teilweise erheblich überschritten.
Die Überschüsse der einzelnen Produzenten wurden, wenn sie
nicht mühsam gelagert wurden, auf dem Weltmarkt abgeladen
und konkurrierten dort gegeneinander um die Absatzmärkte. |
| |
Abgesehen von regionalen oder logistischen Besonderheiten
vollzieht sich der Wettbewerb auf diesem Rohstoffsektor
fast ausschließlich über den Preis. Qualitative Aspekte
spielen eine untergeordnete Rolle und rechtfertigen höchstens
marginale Auf- oder Abschläge. Mit anderen Worten, für die
niedrigen Preise auf dem Weltmarkt ist nicht der eine oder
andere Anbieter verantwortlich, sondern nur das Überangebot.
Die EU-Exportmengen sind Teil dieses Überangebotes. |
| |
Man kann aber leicht ausrechnen, dass sie nur rund 10
% davon ausmachen. Entscheidend ist darüber hinaus, dass
die absoluten Exportmengen seit den frühen 80er Jahren abgesehen
von saisonalen Schwankungen weitgehend konstant geblieben
sind, während sie sich in Brasilien im gleichen Zeitraum
etwa verzehnfacht haben. Es ist somit völlig unverständlich,
warum nur die EU aufgefordert wird, sich aus diesem Markt
zurückzuziehen. Wenn nicht andere ihre Exportmengen kontinuierlich
und auch aggressiv ausgeweitet hätten, hätte längst ein
sehr viel ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage hergestellt werden können. Vielleicht sogar ein
solches, das die EU in die Lage versetzen würde, ihre Exporte
ohne Subventionen durchzuführen. Aus dieser Perspektive
sieht es so aus, dass nicht der EU-Preis zu hoch ist, sondern
der Weltmarktpreis zu niedrig. |
| |
Und dann zu der Frage des Exportdumpings, dass mir so
als Fußnote in einer der Fragen auftauchte, aber hier in
der Diskussion auch schon eine Rolle gespielt hat. Wir vom
Handel sind nicht der Auffassung, die EU betreibe ein Exportdumping.
Die Exportsubventionen sind notwendig, um EU-Zucker mit
vergleichbarem Weißzucker anderer Exporteure konkurrenzfähig
zu machen. Die Subventionen folgen dem Markt, sie bestimmen
ihn nicht. Sie sind erforderlich, weil der Weltmarkt infolge
andauernder weltweiter Überproduktion gedrückt ist, unter
dem Druck des EU-Marktes und auch dem der einheimischen
Märkte der meisten Zuckerproduzenten und -exporteure auf
der Welt. |
| |
Subventionen sind eine notwendige Folge der gedrückten
Weltmarktpreise, nicht ihre Ursache. |
| |
Jegliche Erholung des Weltmarktpreises, wie auch jede
Steigerung des Wertes des US-Dollars, in dieser Währung
wird Zucker notiert und gehandelt, hat eine unmittelbare
Verringerung der Subvention zur Folge. Sie sind nichts anderes
als der Ausgleich zwischen dem politisch Gewollten zu Gunsten
des Agrarsektors definierten EU-Preisniveaus und dem jeweiligen
Weltmarkt. |
| |
Folgerichtig gab es während der Zeiten, in denen der
Weltmarktpreis zeitweise sogar erheblich über dem EU-Preis
lag, als Ausgleich keine Exporterstattungen sondern Abschöpfungen.
D. h., Exporteure mussten für die Mengen, die für den Export
anfielen, die Differenz zum höheren Weltmarktpreis bezahlen.
Bis heute definiert sich das Exportprogramm, die jährlich
neu aufgelegte Dauerausschreibung, als, ich zitiere: |
| |
„Ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weißzucker“. Vielen
Dank. |
| Video |
Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft, AbL: |
| |
Schönen Dank Frau Vorsitzende, dass die AbL an dieser
Anhörung teilnehmen kann. Meine Damen und Herren, eigentlich
ist das System der Zuckermarktordnung so schlecht nicht,
wenn man sich mal von bestimmten system-ideologischen Überlegungen
frei macht und wenn man sieht, dass Freihandel, wenn er
denn gefordert wird, auch immer einer bestimmten Interessenlage
geschuldet ist und weniger einer allgemeinen sozial-ökologischen
Bewegung. Um das auf den Punkt zu bringen, Freihandel fordern
immer die Stärkeren, die jeweils Stärkeren, und wenn man
in die Geschichte guckt, auch in die Wirtschaftsgeschichte,
kann man sehen, wie ein und dieselben Gruppen sich in relativ
kurzer Zeit, wenn man es historisch sieht, sich in dem einen
oder dem anderen Lager befinden, gerade nach ihrer Interessenlage.
Also ist das System so schlecht nicht, dass wir eine Produktion
an Quoten gebunden und auf den Verbrauch der EU eingestellt
haben. Wir haben eine Zufuhr von privilegierten Mengen aus
Ländern der Dritten Welt, also aus Ländern, die wir durch
diese Handelsbeziehungen fördern wollen. Soweit wäre das
ja auch in Ordnung gewesen, weil auch festgelegt war, dass
dieses System haushaltsmäßig neutral sein sollte, also keine
öffentlichen Gelder in diesem Bereich verwendet werden sollten.
Leider hat dieses schöne System nicht lange überdauert,
weil die unterschiedlichen Interessensgruppen dieses System
hemmungslos ausgenutzt und pervertiert haben. Irgendwann
wurde der Staat in Anspruch genommen, diese 1,6 oder 1,8
Mio. Tonnen AKP-Zucker mit Steuergeld wieder zu reexportieren.
Dann hat die Zuckerindustrie Einfluss genommen, die Bauern
über die A- und B-Quote hinaus zur C-Zuckerproduktion anzureizen,
der ja nur mit einem Zehntel des Preises für Quotenzuckerrüben
bezahlt wurde. Durch Bauerngelder wurde damit ein Dumpingeffekt
erzielt, indem man diesen nun auf den Weltmarkt brachte,
aber der Dumpingeffekt war der gleiche. Warum die Bauern
den C-Zucker angebaut haben, ist eigentlich wenig erklärlich,
weil man zu diesen Preisen hier keinen Zucker anbauen kann.
Könnte man es, könnte man die Zuckermarktordnung ja fallenlassen,
wenn das eine lukrative Sache wäre. Die zuckerverarbeitende
Industrie konnte damit ja ganz gut leben, auch wenn Ihr
Statement eben in die andere Richtung ging, sind ja Ihre
Zahlen, was Sie an Umsatz machen und an Arbeitskräften haben,
imposant. Wir haben sie ins Verhältnis gestellt zur Zuckermarktordnung,
es ist vielleicht nicht ganz richtig, weil Sie ja nicht
nur Zucker produzieren, sondern auch noch etwas anderes.
Aber immerhin haben Sie ja offensichtlich mit dieser Sache
ganz gut gelebt. Starke Industrie, das soll es ja auch sein,
das wünschen wir uns ja eben in der Europäischen Union. |
| |
Also könnte man sagen, nicht Aufhebung dieser Zuckermarktordnung
ist das Gebot der Stunde, sondern die Rückführung auf die
Vernunft, die in dieser Zuckermarktordnung lag und liegt.
Das geht nicht mit dem Vorschlag der Kommission. Es geht
ja nicht nur um die Frage, ob wir 35 oder 37 % Preissenkung
haben, sondern hier ist eine andere Logik dahinter. Dies
ist der Beginn der Freigabe, aber nicht die Frage, wie hoch
die Kürzungen ausfallen und das ist gefährlich. Der Weg
ist gefährlich und er würde ja auch nicht dazu führen, dass
unbedingt weniger Zucker hergestellt wird, sondern er würde
billiger hergestellt und es würde eine Verlagerung sowohl
in den Zuckerfabriken, die ja jetzt immer schon stattfindet,
auch bei den Quoten und dem hohen Preis, aber vor allen
Dingen in der Landwirtschaft stattfinden. Einige Bereiche
in der Europäischen Union würden höchstwahrscheinlich aus
der Zuckerproduktion herausfallen und wenn sie ohnehin daran
gekoppelt ist, dass man ein Schutzsystem hat, dann können
die Gegenden, die ertragsmäßig schwächer sind, natürlich
fragen, warum denn bei uns nicht, warum sollen die Quoten
aus Portugal und aus Spanien Richtung Deutschland und Frankreich
abwandern. Diese Länder wehren sich ja gegen den Vorschlag
der Kommission, dass man grenzüberschreitende Quotenüberlieferung
machen kann. |
| |
Deswegen schlagen wir vor, also die Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft, die Sache über die Menge zu regeln
und zwar drastisch. Wir wollen eine 25 %ige Kürzung der
A-Quote und das Verbot des Exports von C-Zucker. Wenn C-Zucker
hergestellt wird, wir wollen nicht an die Erzeugung gehen,
wenn das einer weiterhin machen will für 50 Pfennig oder
eine Mark oder 50 Cent oder einen Euro oder etwas mehr,
dann sollen sie das tun, aber dann kann man es auch gut
in die Biogasanlage schütten. Zu dem Preis kann man es allemal
verwerten oder man könnte an Bioethanol denken, wobei ich
persönlich da etwas zurückhaltend bin, ob sich das überhaupt
rechnet, aber mindestens zu diesem Preis würde es sich rechnen,
dann würden die Zuckerfabriken auch mit drin sein. Es wäre
jedenfalls besser, als mit diesem Zucker Dumping zu betreiben
und diesen Weltmarktanteil, auch wenn er wie Sie sagen nur
mit 10 % aus der Europäischen Union aufgefüllt wird, zu
bedienen, weil nämlich die Vorteile, die die Länder der
Dritten Welt, die an den Präferenzlieferungen in die EU
zu den Bedingungen hier beteiligt sind, haben, konterkariert
würden durch die Zerstörung des Marktes auf den sie ja auch
angewiesen sind. Von daher ist es richtig, dass ist nicht
nur allein der EU geschuldet, da ist sicherlich Brasilien
mit ganz anderen Mengen am Werk und wir sollten uns herausziehen. |
| |
Ich habe der Zuckerindustrie in den vergangenen Jahren
häufiger gesagt, dieses pervertierte System fliegt euch
um die Ohren, und nun haben wir diese Situation und können
nur mit Unterstützung der gesellschaftlichen Diskussion
möglicherweise dieses vernünftige System retten. Denn interessanter
Weise ist eben auch aus entwicklungspolitischer Sicht diese
Zuckermarktordnung und die Präferenzzugänge ja nicht unwichtig,
weil auch diese Länder mit der Zuckerrohrproduktion in Brasilien
nicht konkurrieren könnten. Die würden nicht den europäischen
Markt beliefern, wenn wir freigeben. |
| |
Und aus sozialer Sicht kann man ja davon ausgehen, wenn
wir eine Freigabe hätten, dass nicht die Landlosen in Brasilien
demnächst den Zucker für Europa produzieren würden oder
das sich die Sozialbedingungen oder auch die ökologischen
Bedingungen dort ändern oder verbessern würden. |
| |
Ich meine wir sollten darauf hinweisen, nur in dieser
Schlichtheit wird es ja nicht passieren, dass ist ja auch
klar. Folglich bleibt ja nur, dass wir auch bei der Vergabe
des Zuckers, und es soll ja mehr Zucker vergeben werden,
hier sozial-ökologische Kriterien anlegen. Auch, dass ist
ja vorhin schon gesagt worden. Bei der Verteilung in den
AKP-Ländern wird man zu einer anderen Beurteilung kommen
müssen. Aber das sind Details, die man dann ja mit den entsprechenden
Ländern aushandeln kann. |
| |
Bei der Frage der Zuckerproduktion hier sind wir der
Ansicht, dass diese Kürzung stattfinden sollte mit einer
Freiquote pro Betrieb von 1.000 Doppelzentnern, d. h. wir
möchten die kleineren Produzenten von dieser Kürzung freistellen
oder jedenfalls, wenn sie darüber hinausgehen, etwas stärker
schonen und wir möchten, weil hier immer vom sozial-ökologischen
Anbau gesprochen wird, dass nun auch Ökologie in den Anbau
der Zuckerrüben eingeführt wird. Dazu gehört, dass nur 25
% der Fruchtfolge mit Zuckerrüben angebaut werden sollten.
Wenn man den C-Zucker wegnimmt und der fällt weg, sind einige
auch schnell wieder bei dieser Größe. Das ist für die Betriebe,
die heute in den entsprechenden Gebieten in ganz andere
Prozentsätze gehen, vielleicht etwas schmerzlich, aber etwas
schmerzlich ist immer besser, als wenn die ganze Ordnung
fällt. Wir sind der Ansicht, dass diese Zuckermarktordnung
nur gerettet werden kann, wenn sich alle Gruppen der gesellschaftlichen
Diskussion in diesen sozial-ökologischen entwicklungspolitischen
Fragen stellen. Das in Europa also durch eine gesellschaftliche
Diskussion gestärkt hervorgehende System hätte nach meiner
Ansicht auch Aussicht in den WTO-Verhandlungen akzeptiert
zu werden, weil wir auf bestimmte Kriterien hinweisen können,
die zwar möglicherweise nicht vom System her WTO-konform
wären, von den Wirkungen wäre es aber WTO-konform und von
daher fände ich es ordentlich, wenn die unterschiedlichen
gesellschaftlichen Kräfte, auch die unterschiedlichen Interessenslagen
der einzelnen Gruppen hier zu einer einheitlichen Linie
finden könnten. Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass
ich ganz besonders auf die Zuckerrübenbauern und -bäuerinnen
abheben möchte, weil wir nämlich Gefahr laufen könnten,
dass wir demnächst die Zuckerrübenfabriken in Europa an
den Küsten angesiedelt haben, weil die Rohstoffverarbeitung
in einigen Ländern nicht den Ansprüchen der hiesigen Industrie
entspricht und wir die Rohstoffe dann nur von außerhalb
bekommen. Dieser zuckerrohrverarbeitenden Industrie wäre
das dann ziemlich egal. Ich will nicht sagen, dass wir den
Bauern nicht im Blick haben, aber sagen wir von ihrer ersten
Interessenslage. Man sollte doch in der zuckerverbrauchenden
Industrie auch sehen, dass diese Qualität, die hergestellt
wird, auch die Sicherheit des Angebotes, auch auf der Positivseite
angesiedelt werden sollte und möglicherweise könnten wir
sie ja bei einer breit angelegten Koalition mit in unser
Boot bekommen. Frau Vorsitzende schönen Dank. Ich bin damit
am Ende meiner Ausführungen. |
| Video |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Danke schön, das nächste Mal müssten Sie sich etwas kürzer
fassen. Wir gehen also jetzt in die Diskussion. Wir hatten
mal zusammengestellt, wo denn eigentlich die Unterschiede
in den einzelnen Bewertungen liegen und auch in der Diskussion
muss man ja sehen, dass die Zustimmung vorbehaltlos eigentlich
nur vom IZZ, also von den Zuckerverwertern, geäußert worden
ist. Alle anderen hatten mehr oder minder große Abweichungen
bzw. Bedingungen und als erstes herauszustellen ist ja die
Preisdiskussion. Ich denke, zu einem großen Teil an den
Hinweis, dass die von der Kommission vorgeschlagene Preissenkung
in dieser Höhe nicht für akzeptabel, nicht für sinnvoll
und nicht für realistisch für die deutsche Zuckerwirtschaft
gehalten werden. Aber auch von Seiten der Vertreter der
Entwicklungsländer bzw. der Organisationen, die sich in
diesem Bereich bewegen, kam der Hinweis darauf, das auch
hier für die entsprechenden LDCs- bzw. AKP-Staaten ein gewisses
Regime notwendig ist. Dann der Bereich Quotenkürzung. Auch
hier haben wir darüber diskutiert, dass brauche ich jetzt
nicht alles zu wiederholen. Beim Quotenregime gab es auch
etwas unterschiedliche Vorstellungen, hier von der AbL gefordert,
mit einer Grundquote. |
| |
Im Hinblick auch auf die Fragen des grundsätzlichen Freihandels
bzw. einer Beibehaltung, wie Herr Buntzel-Cano das formuliert
hat, eines Zollkontingentssystems gab es eher eine starke
Tendenz bei den Sachverständigen zur Beibehaltung des Systems
mit Ausnahme von IZZ wiederum. |
| |
Also ich denke in diesem Kontext werden wir hier weiter
diskutieren und ich glaube, die Frage, die Herr Isermeyer
am Anfang gestellt hat, nämlich ob man die EU wettbewerbsfähig
machen kann, und es sich also hier um eine Strategie der
Abwicklung oder um eine Strategie des Austarierens von fairen |
| |
Handelsbedingungen weltweit auch im Hinblick auf erfolgreiche
WTO-Abschlüsse handelt, muss diskutiert werden. Ich denke,
diese Frage werden wir auch politisch beantworten müssen
und es wäre schön, wenn Sie uns bei dieser Beantwortung
auch in der weiteren Diskussion weiter helfen. |
| |
Ich würde jetzt als allererstes gerne die Berichterstatter
der Fraktionen zu Wort kommen lassen. Ich denke, wir machen
drei Runden, á 6 Wortmeldungen. Ich denke, dass werden Sie
verkraften. Ich würde Sie auch im Hinblick auf die vielen
Gäste, die hier sind und ja nicht fragen können gerne anregen,
ruhig auch gegenseitig auf Ihre Argumente einzugehen, also
nicht immer, wenn Sie genannt werden, brauchen oder dürfen
Sie sich zu Wort melden, sondern auch darüber hinaus, damit
wir eine lebhafte Diskussion bekommen. Man muss sich aber
nicht wiederholen. |
| Video |
Abg. Gustav Herzog: |
| |
Vielen Dank Frau Vorsitzende. Zunächst herzlichen Dank
an unsere Sachverständigen für ihre Vorträge, die noch einmal
zusammengefasst haben, was Sie uns in Ihrer schriftlichen
Vorlage überlassen haben, die zum Teil ja auch sehr ausführlich
sind und sicherlich eine gute Grundlage sind für die Diskussion,
von der ich jetzt ausgehe, dass sie uns noch ein Jahr begleiten
wird, mindestens bis zu den WTO-Verhandlungen in Hongkong
im Herbst/Winter nächsten Jahres. Es war nicht überraschend,
dass auch Sie heute Morgen Ihre Einschätzung sehr widersprechend
vorgetragen haben, so dass man nach dem Lesen Ihrer Vorlagen
den Eindruck behält, dass man sich aus einem großen Korb
von alles oder nichts das aussuchen kann, was man als eigene
Einschätzung gerne hätte. Da will ich eins aufgreifen, was
Herr Prof. Isermeyer sehr offen und pointiert geschrieben
hatte und diese Frage richte ich an alle, die auch über
Produktionskosten geredet haben. Herr Isermeyer, Sie haben
geschrieben, Sie beziehen sich auf eine Studie LMC, hätten
aber diese Quelle und die Zahlen, die da genannt werden,
nicht überprüfen können. Das macht mich schon nachdenklich,
wenn hier mit Zahlen gearbeitet wird, bei denen nicht klar
ist, auf welcher Grundlage sie erarbeitet worden sind. Deshalb
meine Frage an alle: |
| |
Verwenden Sie die gleiche Quelle für Ihre Einschätzungen
oder haben Sie unabhängig Daten erheben können. |
| |
Das zweite wurde in Ihren Vorlagen auch sehr unterschiedlich
eingeschätzt, wie verhandelt werden soll, ob Vorfestlegungen
vernünftig sind, ob es sinnvoll ist jetzt darüber zu sprechen,
wie man auf das WTO-Panel reagiert oder ob man, wie es der
Bauernverband und NGG formuliert haben, sagt, am besten
warten wir erst alles einmal ab und dann fangen wir an.
Die Frage ist, ob es nicht besser ist die Anpassungszeit
zu nutzen und jetzt auch den Landwirten zu sagen, dass über
die Notwendigkeit und die Unabweisbarkeit keine Zweifel
bestehen. Das war auch eine Übereinstimmung in dieser Runde. |
| |
Und da geht meine Frage dahin, weil Sie dies verschiedentlich
angesprochen haben, ob das Eleganteste ein Mengengerüst
wäre, in das das, was historisch auch so irgendwo zusammengewachsen
ist, z. B. die Verträge mit den AKP-Staaten, was wir für
die LDC-Staaten beschlossen haben, möglicherweise noch die
USA als Partner, und was Herr Buntzel-Cano mit seinen Zollkontingenten
angesprochen hat, eingebaut werden kann? Wie realistisch
ist es überhaupt, ein solches Mengengerüst im Hinblick auf
die WTO-Verhandlungen zu packen und dann sozusagen eine
ganze Reihe in einem klaren Zeithorizont zu klären? Und
eine letzte Frage, weil die Kolleginnen und Kollegen auch
ihre Gelegenheit haben sollten, eine Detailfrage. Herr Bär
war der einzige, der das Thema Isoglucose angesprochen hat.
Entspricht es der Bedeutung des Themas, dass es nur der
Herr Bär gemacht hat oder haben Sie sich so kurz gefasst,
um diese Detailfrage nicht anzusprechen? Interessant ist,
dass ich nirgendwo lesen konnte, warum diese Entscheidung
so von der Kommission getroffen worden ist. Vielleicht können
Sie mir da weiterhelfen. |
| |
Abg. Marlene Mortler: |
| |
Ich habe eine Frage an Prof. Isermeyer. Herr Isermeyer,
Sie haben davon gesprochen, dass es ja EU-Strategie sei,
zu sagen, wir müssen die Landwirtschaft fit machen für den
Wettbewerb. In Ihren weiteren Ausführungen sind Sie aber
zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie gerade bei Zucker Zweifel
haben und sogar davon ausgehen, dass das Ganze, wenn es
quasi um die Reform der Zuckermarktordnung geht, ins Leere
laufen würde. Ich wünsche mir hierzu noch nähere Erläuterungen. |
| |
Die nächste Frage geht an IZZ. Ihnen ist ja wahrscheinlich
schon tausendmal die Frage gestellt worden, warum der Verbraucher
mit einer radikalen Zuckermarktreform entlastet werden würde. |
| |
Vielleicht haben Sie inzwischen eine bessere Antwort
dazu. Zweitens haben Sie in Ihren Ausführungen von 400.000
Beschäftigten gesprochen mit einem Umsatzvolumen von 40
Milliarden und Sie haben weiter in Ihren Ausführungen davon
gesprochen, dass gerade die exportorientierten Unternehmen,
sollte der aus Ihrer Sicht überhöhte Zuckerpreis und die
sinkenden Exporterstattungen weiter Fakt sein, viele zuckerverarbeitende
Unternehmen in den Bankrott treiben würden. Dazu möchte
ich nähere Erläuterungen und auch noch einmal zu der Entwicklung
der Beschäftigtenzahl, zu diesen 400.000 Menschen, in den
letzten zehn Jahren. |
| |
Abg. Friedrich Ostendorff: |
| |
Ich denke wir sind hier bis auf IZZ wirklich, wie die
Vorsitzende schon feststellte, inzwischen in vielen Fragen
relativ nah beieinander. Wir diskutieren ja heute nicht
das erste Mal, das ist ja auch klar. Wir werden auch weiter
diskutieren, auch wenn die Versammlung am Mittwoch nun leider
in den Agrarausschuss gelegt worden ist, warum auch immer.
Die Frage, die für uns hier ansteht ist ja im Grunde das,
was Herr Isermeyer am Anfang schon sagte. Gehen wir in die
Diskussion mit dem Fischler-Vorschlag oder haben wir auch
einen Vorschlag, der stärker auf Quotenabsenkung und weniger
stark auf Preisabsenkung geht, ins Auge zu nehmen. Ich denke,
dass Herr Graefe zu Baringdorf das ja ausgeführt hat und
hier haben wir uns von Seiten der Grünen dazu bisher so
positioniert, dass wir diesen zweiten Vorschlag für wesentlich
Zielführender halten, die Verbrauche mehr in den Focus zu
nehmen und die inländischen Verbrauche mit der Anbaumenge
hier und der Anbaumenge der 49 ärmsten Länder zusammenzubringen.
Hier noch einmal die Frage an Sie Herr Graefe zu Baringdorf.
Sie sprachen vom qualifizierten Außenschutz. Wie soll der
denn aussehen? Wie kriegen wir das abgesichert? Die Frage
aber auch an Herrn Buntzel-Cano, ob dieser Weg auch von
den Nichtregierungsorganisationen, die Sie vertreten, mitgegangen
werden kann und unter welchen Bedingungen. Hier klingt ja
immer wieder an, dass man auch die 49 ärmsten Länder wettbewerbsfähig
machen und alte Strukturen erneuern muss. Ist es richtig,
wie manchmal geäußert wird, diesen Prozess der Integration
dieser 49 ärmsten sehr schnell zu gehen oder können Sie
sich auch vorstellen, insoweit geht die Frage auch an Herrn
Graefe zu Baringdorf, diesen Prozess so wie die 49 ärmsten
sich positioniert haben, etwas längerfristig zu gestalten?
Das wäre für uns eine wichtige Frage, die wir noch einmal
mit den Experten besprechen möchten. |
| |
Abg. Hans-Michael Goldmann: |
| |
Frau Vorsitzende, sehr verehrte Sachverständige, man
sagt das ja immer bei Anhörungen, aber wirklich ganz herzlichen
Dank für Ihre Ausarbeitungen, die Sie uns zugeleitet haben
und die für mich und für meine Fraktion die Grundlage der
weiteren Arbeit sein werden. Ich will das hier auch noch
einmal betonen, was Kollege Ostendorff auch ansprach. Wir
haben in dem Szenario: |
| |
Alles liberalisieren, nichts ändern oder einen mittleren
Weg beschreiten, die Fischler-Vorschläge. Nur ich meine
auch, dass wir innerhalb dieser Fischler-Vorschläge durchaus
Handlungsspielraum haben und dass wir den dann ausgestalten
wollen. Da sind eben auch schon von meinen Kollegen, wie
Herrn Ostendorff, Fragen gestellt worden, mit denen wir
uns intensiv zu befassen haben, ob sich so etwas mit qualifiziertem
Außenschutz überhaupt realisieren lässt, wobei ich persönlich
betonen will, dass ich das für nicht realisierbar halte,
nachdem was mein Kenntnisstand ist. Wie gesagt, herzlichen
Dank für diese Aufträge, die wir durch Sie bekommen haben
und wir möchten dann natürlich auch mit Ihnen im Gespräch
bleiben, weil es überhaupt nicht zu einer Lösung kommen
kann, die vom Zaun gebrochen wird, sondern wir müssen hier
möglichst viele mitnehmen. |
| |
Grundlage meiner Kernfrage, die hat Herr Herzog auch
aufgegriffen, wäre auch die Aussage von Herrn Isermeyer,
die man sicherlich auch noch ein Stück durchgeben kann durch
die Reihen der Sachverständigen. Wenn ich Herrn Isermeyer
richtig verstanden habe, sagt er ja okay, wir gehen diesen
mittleren Weg, aber dieser mittlere Weg ist möglicherweise
in der Relation Quotensenkung/Preissenkung nicht so ausgewogen,
wie er sein sollte, aber auf die Dauer zementieren wir im
Grunde genommen ein Sondermodell Zucker. Da nehmen wir uns
Partner, das können, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
die USA und die AKP-Staaten sein, aber wir bleiben bei einer
Sondermarktsituation für Zucker, die wir sonst in keinem
anderen Agrarbereich in dieser Ausgestaltung haben. Wir
federn das dann noch einmal ab an der einen oder anderen
Stelle mit Sonderregelungen für AKP, mit Sonderregelung
für Least Developed Countries, aber es bleibt bei dieser
Sondersituation. Da würde ich gerne von den Beteiligten
hier wissen, ist so was realistisch, ist das vor dem Hintergrund,
was wir bis jetzt an Erfahrungen gesammelt haben, bei WTO-Verhandlungen
allerdings auch bei Klagesituationen, die wir ja nicht nur
im Agrarbereich haben, die wir z. B. auch in einer Situation
haben, die meinen Heimatort betrifft, z. B. bei Wettbewerbshilfe
für den Chipbau, ist das überhaupt realistisch? Herr Graefe
zu Baringdorf, Sie haben die Rückführung auf die Vernunft
angesprochen und da würde mich doch etwas konkreter interessieren,
wie Sie sich dauerhaft diese Vernunftsausgestaltung, gerade
auch in der Fragestellung, die ich eben an Herrn Isermeyer
gestellt habe, denken. Der IZZ-Vertreter hat gesagt, die
Belastungen sind weitgehend neutral. Ich würde gern Herrn
Dr. Gebhardt fragen oder auch den Vertreter des Bauernverbandes,
Herrn Bär, Sie haben ja in Ihren Ausführungen eine andere
Beurteilung abgegeben, die weit entfernt ist von Neutralität
und da würde ich mir doch noch einmal wünschen, dass Sie
das miteinander noch einmal austauschen. An den Vertreter
des Bauernverbandes noch einmal die Frage, auf Seite 2 sagen
Sie: Mit Ihren Vorschlägen hat die EU-Kommission jedoch
ein Reformpaket vorgelegt, das weit über die tatsächlichen
Reformnotwendigkeiten hinausgeht. Da würde mich mal interessieren,
wo dieses Reformpaket über das hinausgeht, weil ich persönlich
der Meinung bin, dass wir möglicherweise durch das Inkrafttreten
des Panelurteils im Grunde genommen ein Stück hinter dem
zurück sind, was von uns möglicherweise in ganz kurzer Zeit
verlangt wird. |
| |
Abg. Dr. Wilhelm Priesmeier: |
| |
Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Ich hätte eine konkrete Frage an den Vertreter des IZZ.
Wie hoch ist denn der Bruttoeinsatz an Zucker in Ihrem Bereich,
um da mal ein Verhältnis zu sehen zwischen Ihrer Wertschöpfung
von brutto etwa 40 Milliarden und zwischen dem, was Sie
überhaupt an Zucker einsetzen. Das würde ja vielleicht einiges
deutlich machen, auch in Bezug auf die Wichtigkeit dieser
Entscheidung und auch auf die Wichtigkeit des Zuckerpreises
für Ihre Branche. Auf der anderen Seite eine Frage an Herrn
Isermeyer und vielleicht in dem Zusammenhang auch an OXFAM.
Wie stellt sich das denn dar in der Systematik, die jetzt
zu entwickeln ist, denn es ist ja wohl davon auszugehen,
dass es nach dem Auslaufen der jetzigen Zuckermarktordnung
mit Sicherheit zu einem neuen Marktordnungsmechanismus kommen
wird und ein geregelter Markt kann nur existieren, wenn
ich letztendlich auch Quoten in entsprechender Systematik
festlege. Ist es evtl. erforderlich, diese bisherige Quotensystematik,
wie wir sie im europäischen Zuckermarkt haben, grundsätzlich
zu überdenken und neu zu denken? Ist es z. B. vorstellbar,
dass man die Quotenrechte dann den jeweiligen Produzenten
zuteilt, in der Weise, dass man dort entgegen den bisherigen
Vorgaben unter Umständen Kontingente bezogen auf eine bestimmte
definierte Menge Weißzucker austeilt und ist in dieses Quotensystem
unter Umständen dann auch in die internationale Ebene mit
einzubeziehen? Denn bei der Größenordnung der vermeintlichen
nicht berechenbaren Produktion der LDCs wäre es ja notwendig,
den Gesamtzusammenhang so zu organisieren, dass sich die
vermeintliche Quotenmenge in irgendeiner Form dort wieder
findet, wenn man eine langfristige Regelung präferiert.
Ansonsten wäre man zu den gegebenen Zeitpunkten immer wieder
gezwungen, neue Nachverhandlungen zu führen. Dann ist die
andere Frage auch, wie sich denn der Verhandlungsmechanismus
direkt darstellt. Auf welcher Ebene und in welchem Gremium
sollen denn direkte Verhandlungen zwischen potentiellen
Interessenten, sprich AKP, LDC und der EU geführt werden?
Unter Umständen bei Ländern, die bislang noch gar keinen
Zucker produzieren, sondern erst beabsichtigen, in Zukunft
Zucker zu produzieren und wie sollen deren Interessen dann
im Rahmen dieser Quotierung festgelegt werden. Das sind
also Dinge, die mir im Augenblick zumindest auf dieser Ebene
recht fragwürdig und nicht darstellbar erscheinen. |
| |
Aber es geht ja darum im Vorfeld für die Entscheidung
der EU, wenn es denn dort zu einem Legislativvorschlag kommt,
auch eine gewisse Linie darzustellen, wo man dann auch verhandlungsfähig
auf der internationalen Ebene wäre, auf der europäischen
Ebene. Darauf bezogen ist natürlich auch dann die Frage
zu stellen, wie denn die Systematik innerhalb unserer eigenen
Zuckererzeugung aussieht. Wenn wir denn kein Interventionssystem
im eigenen Sinne mehr haben, wie stellen wir das dar? Tragen
wir die jeweilige C-Zuckermenge auf das nächste Produktionsjahr
vor? Ich kann mir einen anderen Mechanismus im Augenblick
nicht vorstellen, denn der Mechanismus der privaten Lagerhaltung
wird mit Sicherheit nicht das erfüllen, was man von ihm
erwartet. Wie ist die Einschätzung dessen? Ich meine, WTO-konform
ist ja immer noch die bisher präferierte Menge, die wir
auf Grund der alten Vereinbarung in den Weltmarkt exportieren
dürfen. Angegangen im Rahmen des WTO-Panels ist ja nur die
Art und Weise der vermeintlichen Verknüpfung des C-Zuckerexportes
mit Quersubventionierung und zum anderen die Menge dessen,
was wir an AKP-Zucker reexportieren. |
| |
Das heißt in dem Zusammenhang ist natürlich die bisherige
Regelung der Zuckermarktordnung an sich noch konform, wenn
wir uns an die Vorgaben halten, die wir eigentlich hätten
einhalten müssen. |
| |
Der EU-Zuckermarkt wird ja nicht entscheidend wachsen,
sondern wir werden ja in etwa auf der Größenordnung des
Verbrauches verbleiben, wie wir ihn bisher auch haben. Das
heißt, die Menge des Verbrauches ist ja wohl zu kalkulieren
oder auch zu bewerten. Das müsste dann natürlich auch in
dem Zusammenhang zur Grundlage dessen gemacht werden, was
wir hier an Quoten insgesamt für den gesamteuropäischen
Markt austeilen. Es gibt eine Reihe von offenen Fragen,
gerade in dem Bereich was die Mengenregulierung dieses Marktes
angeht, was von ganz entscheidender Qualität auch in der
Diskussion sein dürfte. Darüber hinaus ist natürlich die
Frage zu stellen, ob wir einen Markt über den Preis überhaupt
regulieren können. Ich glaube, es ist ganz deutlich geworden
aus den Ausführungen des Prof. Isermeyer, dass wir im Rahmen
der Neustrukturierung der Zuckermarktordnung eine grundsätzliche
Entscheidung zu fällen haben, ob wir eine Zuckerproduktion
in Europa behalten wollen über Rübe, denn naturgemäß wächst
in Europa kein Zuckerrohr, oder ob wir das nicht wollen.
Wenn wir das denn wollen und ich sehe das so voraus, dass
wir das wollen, ist die Frage, mit welchem Mechanismus wir
das darstellen können und wo es denn auf der internationalen
europäischen Ebene auch Allianzen gibt für Positionen, die
wir als deutsche Position entwickeln können, im Kontext
derer, die ein großes Interesse an der europäischen Zuckermarktordnung
haben, nämlich Frankreich, Deutschland und Polen. Und wie
sehen Sie dort unter Umständen gemeinsame Linien, die man
in ein gemeinsames Konzept im Verhältnis zu den Ländern
bringen könnte, die keine großen Interessen im Zuckermarkt
haben? Das wäre sehr wichtig. |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Darf ich jetzt mal stoppen. Bevor wir alle Fragen von
allen Abgeordneten dieser Legislaturperiode zu diesem Bereich
vorwegnehmen, hören wir hier auf. So Herr Schindler. Übrigens
er ist der Berichterstatter, Frau Mortler ist die Sprecherin.
Das wollen wir doch noch einmal richtig stellen. |
| |
Abg. Norbert Schindler: |
| |
Vielen Dank Frau Vorsitzende. Zunächst eine Anmerkung
von vorhin als Antwort. Wenn am Mittwoch die Tagung in Berlin
ist; ich bin ja Mitglied des Finanzausschusses und wir machen
das öfters oder es kommt auch vor, dass wir den Ausschuss
dann unterbrechen und eine wichtige andere Veranstaltung
besuchen, Herr Herzog. Das praktizierten wir in der Vergangenheit
des Öfteren. Jedenfalls bin ich um 11.00 Uhr bei dieser
Tagung am Mittwoch. Nur so als Anregung zum Nachdenken. |
| |
Herr Oetzel, die erste Frage geht an Sie. Garantieren
Sie dem europäischen Verbraucher, dass Coca Cola dann so
teuer wird wie in Brasilien, obwohl dort Weltmarktpreise
herrschen, oder geben sie den Preis wirklich durch? Dann
würde man ja Ihrer Argumentation folgen können. Man kann
es schlecht glauben aus der Sicht der Erfahrung der Vergangenheit,
denn als bei Weizen die Angleichung an den Weltmarktpreis
durchgeführt wurde, hat es keiner in der Bäckerei oder einer
Großbäckerei gemerkt, es wurde also nicht durchgereicht.
Und deswegen der Anteil von 0,5 oder 3 Cent an einer Tafel
Schokolade oder einem Mars-Riegel, dass erfüllt uns schon
mit großen Zweifel, ob dies dann so eintreten würde und
welchen Preisvorteil europäische Verbraucher hätten. Dann
auch noch mal eine Klarstellung. Der Kollege Goldmann soll
gut zuhören. Im Panel in der WTO reden wir über sensible
Produkte und da geht es nicht nur um Zucker. Ein sensibles
Produkt in der Besonderheit war auch Entwicklungshilfe der
besonderen Art, indem die AKP-Staaten vor einigen Jahren
eine indirekte Entwicklungshilfe bekommen haben, die die
europäischen Rübenanbauer direkt oder indirekt finanziert
haben. Das muss man nur noch einmal in Erinnerung rufen.
Heute ist das abgeräumt nach dem Motto, dass geht sie alle
an. Ich bin Ihnen allen dankbar, außer der IZZ, dass die
Aussage da ist und Sie es für notwendig halten, dass ein
Mengenregime erhalten bleibt bzw. eine Quote. Trotzdem die
Frage politisch gesehen an Herrn Dr. Gebhardt und den Vizepräsidenten
des Deutschen Bauernverbandes, Herrn Bär: |
| |
War es notwendig, dass Fischler mit oder ohne Not diese
Vorschläge schon macht, obwohl im Panel noch heftig gestritten
wird, wie sich die Zuckerpolitik der EU auf den Weltmarkt
auswirkt? Zum Zweiten an die beiden genannten Personen und
auch an Sie Herr Isermeyer: |
| |
Wenn wir ein Mengengerüst und ein Quotensystem in der
jetzigen vorgeschlagenen Form von Herrn Fischler behalten,
ohne das nach unten eine Durchsicherung passiert, hat dann
überhaupt ein Abwehrmechanismus innerhalb der Europäischen
Union noch einen Zweck, oder rutschen wir nicht nur unter
die 430, sondern vielleicht sogar auf die 220 Euro pro Tonne?
Und die letzte Frage an den Deutschen Bauernverband. Welche
Auswirkungen sind für die 48.000 landwirtschaftlichen Betriebe
zu befürchten, die direkt mit der Zuckerproduktion zu tun
haben, würde sich nur die Stufe 1 politisch durchsetzen
lassen und welche Auswirkungen wären bei der Stufe 2 zu
befürchten in den Ackerbauregionen in unserer Republik?
Wie viele Höfe würden dafür geopfert werden und welche der
Wertschöpfung geht, Herr Dr. Gebhardt, der gesamten deutschen
Landwirtschaft, nicht nur der europäischen, verloren a)
bei Stufe 1, b) bei Stufe 2. |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Ja herzlichen Dank. Also Sie haben ja nun alle genug
Fragen mitbekommen, denke ich mal und ich würde jetzt anfangen
mit der Beantwortung bei Herrn Graefe zu Baringdorf. In
der zweiten Runde kommen alle dran, die sich weiterhin gemeldet
haben. Bitte etwas kürzer, sonst schaffen wir das nicht
mehr bis 14.00 Uhr. |
| Video |
Friedrich Wilhelm Graefe zu Baringdorf: |
| |
Ja die wichtigste Frage war die nach der Vernunft. Ich
glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft und wenn wir als
Politiker da nicht mehr dran glauben, sondern nur noch an
das Austarieren von Interessenslagen, dann wird es schwierig.
Das war mein Appell zum Schluss. Ich glaube, dass wir bei
der Beurteilung dieser Frage uns von der Festlegung - ich
hatte es ideologische Festlegung genannt – auf bestimmte
Instrumentarien frei machen müssen. |
| |
Die AbL hat bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik
für die Entkopplung gestimmt gegen die Haltung des Bauernverbandes,
der sich dann ja angeschlossen hat, nachdem sie durchgezogen
wurde. Die Entkopplung heißt mehr Markt und ist das Gegenstück
von dem was als Instrumentarium vorgesehen ist. Wir haben
uns dafür entschieden, weil ein Großteil unserer Mitglieder
aus dem Interventionssystem raus gegangen ist und mit besonderen
Produkten an den freien ich sage mal regionalen Markt gegangen
ist. Sie haben gezeigt, dass es am Markt möglich ist, höherpreisige
Märkte zu erzielen mit bestimmten Qualitäten, die es den
Verbrauchern und Verbraucherinnen wert sind. Das ist bei
Zucker schwierig, diesen Weg zu gehen und wir haben bei
der Entkopplung auch erreicht, dass die alte Benachteilung
des Grünlandes im Verhältnis zum Mais aufgehoben wurde.
Wir hatten es ja in der Agenda 2000 als Vorschlag der Kommission,
da haben sich die einflussreichen Kräfte wieder dagegen
gewehrt und es ist alles beim Alten geblieben. Durch die
Entkopplung gibt es keine Maisprämie mehr von der Logik
her. Von daher glaube ich, dass man diese Vernunft, über
die Zielsetzung, auch über die Zielsetzung in den WTO-Verhandlungen
zu reden, mindestens versuchen sollte. Wenn man die Auseinandersetzung
bei den WTO-Verhandlungen und die große Brisanz, die dieses
Thema auch bei Nichtregierungsorganisationen und bei jungen
Menschen erzielt hat, betrachtet, dann finde ich, gibt es
Mut zur Hoffnung, dass wir es hinkriegen, weil auch die
nicht nach den Instrumentarien fragen, sondern sie fragen
danach, wem wird denn damit geholfen, wen stützt das. |
| |
Das Europäische Parlament hat sich für den qualifizierten
Außenschutz ausgesprochen. Fischler hat in den WTO-Verhandlungen
mit Auftrag des Agrarausschusses des Europäischen Parlaments
den qualifizierten Außenschutz vor den Exportsubventionen
verhandelt. Das Ergebnis kennen wir. Nur ist natürlich Qualität
schwieriger zu bestimmen als Quantität. Und da in die Auseinandersetzung
zu gehen, ist gerade in dieser Zuckermarktordnung notwendig,
weil diese Qualitäten ja auch bei der Vergabe von Quoten,
wenn man unserem System oder sagen wir dem von der Mehrheit
vertretenen System folgt, es ja eine Frage ist, wie diese
Quoten nach Qualitäten vergeben werden und da komme ich
jetzt auf die Frage der sog. ärmsten Länder, also des freien
Zugangs. Wir halten beim Zucker diesen freien Zugang für
außerordentlich problematisch und ich vermute, das Europäische
Parlament wird auch hier Quoten befürworten und man kann
sie nach dem jetzigen Zuckeranbau ruhig doppelt so hoch
oder dreimal so hoch setzen, das würde die europäische Interessenslage
nicht vollständig unterlaufen. Lassen wir es aber frei,
ist im ökologischen Bereich zu befürchten, dass es hier
zu Monokulturen kommt. Im Handelsbereich ist zu befürchten,
dass sie als Transferländer gebraucht werden, die nun Zucker
in die Europäische Union bringen. Das ist ja auch die Argumentation,
die Fischler gebraucht hat, warum er mit dem Zucker 37 %
runter geht, weil er sagt, dann lohnt es sich nicht mehr,
den Zucker von dort zu bringen. Ich habe die große Frage,
ob es sich nicht doch noch lohnen wird. Jedenfalls für die
Transfergeschichte würde es sich lohnen. Also ist auch das
nicht geeignet. Fischler sagt, gut, bringen Sie doch die
Quoten mehrheitlich erst einmal bei den Nichtregierungsorganisationen
unter, die gerade ja alles außer Waffen und freien Zugang
auch wieder ideologisch nehmen und das verteidigen werden,
weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist, in diesem
Falle aber gefährlich wird. Das wieder auszukaspern ist
in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nicht so ganz
einfach. |
| |
Zu der Frage des qualifizierten Außenschutzes möchte
ich noch sagen: |
| |
Wir stellen uns vor, dass im internationalen Handel ein
Fond gebildet wird, der gespeist wird von Geldern, die früher
Abschöpfungen genannt wurden, wenn sie denn zum Tragen kommen,
oder aber mit festgelegten Abgaben, die weltweit eine Entwicklung
der ländlichen Räume ins Auge fassen und die Produktion
im Sinne einer sozialökologischen Bewegung. Das ist auch
wieder sehr weit gegriffen. Aber wenn wir das nicht irgendwo
anbinden, dann bleibt der qualifizierte Außenschutz ein
zwar etwas blumiger Begriff, aber er wird sich nicht konkretisieren.
Hier könnte man mit Zucker anfangen und ich würde sagen,
dass wir von den Zulieferungen der Privilegierten einen
Teil in diesen Fond geben. Auch von der europäischen Seite
sollte es einen Zuschuss zu diesem Fond geben, damit soziale
und ökologische Erwägungen jetzt nicht nur auf Zucker, aber
auch auf Zucker auch im Sinne der Modernisierung, damit
Sie mich nicht falsch verstehen, zum Tragen kommen. Ich
finde, dass die ländliche Entwicklung bei uns in Europa
und in den Ländern der Dritten Welt als eine Wirtschaftsentwicklung
und als ein Beitrag zu einer Stabilisierung der Einkommen
aber auch des Volkseinkommens gesehen werden muss. In dem
Sinne könnten wir dann den qualifizierten Außenschutz etwas
konkreter machen. |
| |
Zum Schluss Frau Vorsitzende noch zum Preis. Wir möchten
diese Preissenkung nicht als eine Logik des Ausstiegs aus
der Quote. Wir können und müssen uns natürlich darüber unterhalten,
ob man mit diesen 300 Euro, die demnächst ja auch nach der
deutschen Regelung den Zuckerrübenflächen zu Gute kommen,
was ich den Bauern gönne, darum geht es nicht, den Bereich
der noch am lukrativsten in der europäischen Landwirtschaft
läuft, wirklich so unterstützen muss. Hier muss man diese
Prämie in einem Preisabschlag deutlich machen, die muss
sich da wieder finden. Wir sind dezidiert gegen die Einführung
einer neuen Zuckerprämie, die dann entkoppelt wird. Sie
sehen, auch hier sind wir für die Entkoppelung aus historischen
Überlegungen. Bei der Fragestellung nach Zucker wäre es
gerade zu unsinnig hier noch eine Prämie einzuführen, die
man dann sofort wieder entkoppelt, sondern da muss man moderat
in den Preissenkungen bleiben, jedenfalls was Zuckerrüben
anbelangt. Beim Zucker, das wird jetzt der Zuckerwirtschaft
nicht so gut gefallen, vielleicht etwas mehr der IZZ. In
den Gesprächen, ich habe mit allen Seiten Gespräche gehabt,
wird immer wieder bemängelt, dass es eine ziemliche Monopolstellung
im Zuckerbereich gibt. Wenn man in Süddeutschland kaufen
will, kann man eben nicht ein Angebot aus Norddeutschland
holen oder aus einem anderen Land. Die Zuckerindustrie –
Sie können ja widersprechen - verdient an diesem System
mehr als die Bauern. |
| |
Das ist für mich ein Ärgernis. Von daher möchte ich jetzt
nicht unbedingt, dass man den Bauern das jetzt zu Gute kommen
lässt, dass ist ja ein lukrativer Bereich, sondern es muss
im Bereich des Weißzuckers zu einer Veränderung preislich
und von den Strukturen kommen. Es muss mehr Wettbewerb rein.
Das verträgt sich aber mit dem, was wir von der AbL als
Instrumentarium angeboten haben. Frau Vorsitzende, das war
es glaube ich schon. Danke. |
| Video |
Christian Bär, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes,
DBV: |
| |
Vielen Dank Frau Vorsitzende. Es sind eine Reihe von
Fragen gestellt worden. Ich will das letzte aufgreifen,
was Herr Graefe zu Baringdorf angesprochen hat, als süddeutscher
Rübenanbauer beklage ich, dass norddeutscher Zucker auch
in Süddeutschland verkauft wird und auch umgekehrt. Das
ist jetzt etwas scherzhaft. Dieser Markt findet statt und
die Ware wird transportiert. Das ist in Ordnung. Hier funktioniert
der Markt innerhalb Deutschlands. Es sind eine Reihe von
Fragen an mich gestellt worden. Lassen Sie mich beginnen
mit der Frage nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens und
den Auswirkungen. Die Frage wurde gestellt von Herrn Ostendorff
und von Herrn Schindler. Die Fischler- Vorschläge sind deswegen
zu früh, weil sie die WTO und das Panel in keiner Weise
berücksichtigen und wir sozusagen im Vorfeld schon Leistungen
erbringen von denen man nicht weiß, wie sie im Nachhinein
noch zusätzlich belastet werden. Deswegen glauben wir, ist
es der falsche Zeitpunkt und der falsche Ansatz gewesen. |
| |
Es wurde darüber diskutiert und gesprochen, auch über
Preise. Lassen Sie mich den Boden noch etwas öffnen. Wir
leben hier in dieser Gesellschaft mit den gesellschaftlichen
und politischen Forderungen, was die sozialen und ökologischen
Standards betrifft. Wir Bauern erfüllen das gerne. Da ich
seit 12 oder 14 Jahren auf den internationalen Veranstaltungen
auch der WTO-Verhandlungen für den Deutschen Bauernverband
teilnehme, weiß ich auch, wie in Brasilien und wie in Schwarzafrika
produziert wird und viele der Vertreter, insbesondere der
nichtbrasilianischen Zuckerhersteller, fürchten schlicht
und ergreifend, dass sie dem brasilianischen Ansturm nicht
standhalten werden. |
| |
Wenn man die brasilianischen Bedingungen sieht, dann
kann ich nur sagen, da würde hier nicht ein Gramm Zucker
produziert werden dürfen und zu Recht. Ich will das nicht
weiter ausführen. Ich will nur darauf hinweisen, wenn wir
hier über reine Preise reden. Das ist zum Teil menschenunwürdig,
wie dort Menschen in der brasilianischen sog. Zuckerwirtschaft
arbeiten und produzieren müssen. Wir haben denke ich die
Aufgabe uns für Produktionsbedingungen einzusetzen, die
es ermöglichen, hier unter den gegebenen Anforderungen Zucker
zu produzieren. Die Frage von Herrn Schindler, wie sich
das auf Einzelbetriebe auswirkt, kann man seriös eigentlich
nicht beantworten. Wir können festhalten, dass wir einen
Verlust von in etwa 300 Mio. Euro haben in der ersten Stufe,
in der zweiten Stufe von 360 Mio. Man kann die Frage nach
den Betriebszahlen deswegen nicht seriös beantworten, weil
man ausrechnen müsste, wo die Grenzstandorte in der Produktion
sind. Wir wissen europaweit, dass die mediterranen Bereiche,
also Italien und Spanien, rund 5 bis 6 Tonnen Zucker pro
Hektar produzieren. |
| |
Die guten zwischen 10 und 12, also Frankreich, Deutschland
und Polen, weil es auch angesprochen wurde. Genau diese
gleiche Situation haben wir in Deutschland und in dem Maße,
wie sich europaweit die Zuckerproduktion verändern würde,
würde das auch in Deutschland greifen, mit den Folgen, nicht
nur für die Landwirte, sondern auch dort wo eine Senkung
oder eine Umverteilung der Produktion bei den Zuckerrübenfabriken
nicht möglich wäre. Denn wenn die Reduzierung kommt, 20
oder 27 % weniger, kann das eine einzelne Fabrik in der
Regel nicht abfedern, d. h. sie würde zu machen müssen,
mit dem Ergebnis, dass ganze Regionen möglicherweise, weil
die Rübe ja nicht so besonders transportwürdig ist wegen
ihrer Menge, aus der Zuckerrüben- und damit der Zuckerproduktion
herausfallen. Ich bitte deswegen um Verständnis, dass ich
Ihnen eine seriöse Zahl nicht nennen kann. Ich kann nur
versuchen auf den Trend hinzuweisen. Ich denke, dass war
es für die erste Runde aus meiner Sicht. |
| Video |
Dietrich Oetzel, IZZ: |
| |
Wir wollen es so handhaben, dass ich Stellung beziehe
zu der Verbraucherentlastung und zu den 400.000 Beschäftigten
plus Exporterstattung usw. und die Frage nach der Kostenweitergabe.
Herr Prof. Schmidt wird die anderen Fragen beantworten. |
| |
Prof. Dr. Erich Schmidt, IZZ: |
| |
Vielen Dank. Ich möchte kurz insbesondere zu den Fragen
von Herrn Herzog und von Herrn Goldmann Stellung nehmen
und dabei auch ein bisschen auf Herrn Isermeyers Statement
eingehen, wenn Sie gestatten Herr Kollege. Es ist ja die
Frage nach der Zementierung einer Sonderstellung, das hatten
Sie aufgeworfen, gestellt worden. Dies meine ich sollte
auch ein zentraler Punkt sein, den man im Auge behalten
soll. Die Agrarpolitik ist angetreten, um in der Europäischen
Union marktwirtschaftliche Elemente zumindest einzuführen
oder in einem marktwirtschaftlichen System zu überführen
und im Agrarsektor mit der Zielsetzung, die Wettbewerbsfähigkeit
zu stärken. Nun kann man natürlich sagen, die Zuckermarktordnung
bricht zusammen. Herr Isermeyer ich stimme Ihnen hundertprozentig
zu, wenn wir sie so weiterfahren, wird sie zusammenbrechen.
Die Frage ist natürlich, wo eigentlich der Lösungsweg ist.
Mir scheint, an der Quote festzuhalten und an den Preisen
nichts zu tun, ist das Falscheste, was man tun kann, weil
man ganz genau das nicht erreicht, dass man erreichen sollte,
nämlich die Eingliederung in die Agrarmarktreform und etwas
stärkere wettbewerbsfähige Verhältnisse einzuführen. Lassen
Sie mich das kurz erklären. Es ist nämlich nicht nur eine
Frage der WTO-Geschichten, sondern es ist auch eine interne
Sache. Das was wir überall bemerken oder auch beobachten
in der Wirtschaft ist, das die Kostenstruktur in Ordnung
gebracht werden muss. Dies schaffen Sie niemals, wenn die
Quote erhalten bleibt, weil wir wissen, dass selbst in Deutschland
die Produktionskosten für Zuckerrüben und auch Zucker deutliche
regionale Unterschiede aufweisen. Das gilt natürlich auch
innerhalb der Union. |
| |
Wenn wir also innerhalb der Europäischen Union Allokationseffekte,
das heißt Kostensenkungen und damit Wertschöpfung für den
landwirtschaftlichen Sektor generieren wollen, Individuen
leiden und gewinnen, aber für den Sektor insgesamt, dann
müssen wir die Kosten der Zuckerproduktion runter bringen.
Das können wir nicht mit Quoten, sondern das können wir
nur über die Preise. Und deshalb denke ich, ist der Weg
der Kommission, die Preise auch kräftiger zu senken, richtig.
Wir sind übrigens weit davon entfernt Brasilien Zugang zum
Markt zu verschaffen, weil dass auch durch WTOImportzölle
einstweilen mit Brachialgewalt verhindert wird. Darüber,
ob das gut oder schlecht ist, mag man denken wie man will.
Jedenfalls sehen die Kommissionsvorschläge eine stärkere
Protektion des Binnenmarktes vor, wenn es bei 20 % oder
36 % Zollsenkung bleibt. Die Preissenkung bewirkt mit der
Handelbarkeit der Quote wirklich auch die Wanderung in unsere
wettbewerbsfähigen Regionen und die gibt es. Da würde ich
die Herren und Damen Abgeordneten ganz besonders darauf
hinweisen, weil ich glaube, dass dieses eigentlich der Punkt
ist, auf dem das Verhandlungskapital Deutschlands eingesetzt
werden sollte. Und ich meine, die deutsche Zuckerwirtschaft,
sowohl Rübenanbau und Zuckerindustrie, braucht sich hinter
den Franzosen so furchtbar weit nicht zu verstecken. |
| |
Erstens schaffen wir dadurch Kostensenkungen und zwar
in ganz erheblichem Ausmaß. Es hat mal ein Wissenschaftler
1989 geschätzt, dass allein eine Wanderung in Deutschland
auf die günstigsten Standorte ein Potential von damals 640
Mio. DM also 320 Mio. Euro Kostensenkungen bewirkt, die
bei konstanten Preisen natürlich als Wertschöpfung bei den
Landwirten landen würden. |
| |
Zweitens meine ich, dass eine Preissenkung in dem Ausmaß
des Vorschlags der Kommission auf 420 oder 329 Rohwert den
Anreiz in den Entwicklungsländern drastisch zurückführen
wird. Das ist ganz wichtig, weil die Länder jetzt in den
Startlöchern stehen, unter Umständen sogar mit europäischer
Zuckerindustriehilfe in die Produktion eines Wirtschaftszweiges
zu gehen, in dem sie überhaupt nicht international wettbewerbsfähig
sind. Mauritius ist besser bedient mit einer Direktzahlung,
die nicht 100 Prozent der Exportausstattung ausmachen kann,
sondern auch weniger. Ich bin überzeugt, dass die lieber
diese Direktzahlungen wählen würden und auch Anreize für
Exportgeschäfte, die ja immer drohend im Hintergrund stehen,
sind durch Ursprungsregelung nicht zu kippen. Wenn es zur
Öffnung des Weißwertmarktes kommt, steht es den Entwicklungsländern
zu, Raffinationen aufzubauen und die Raffinerien können
den Zucker in die Europäische Union liefern, weil das eine
Ursprungsänderung von Rohzucker auf Weißzucker bewirkt.
Aber auch da muss man sich bei 421 Euro die Tonne Weißwert
überlegen, ob denn tatsächlich Rohzuckereinkauf, Transportkosten,
Umwandlungskosten und noch einmal Transportkosten in die
EU das alles schafft oder nicht. |
| |
Ein letztes Wort. Ich glaube, dass diese Preissenkung
der Kommission sinnvoll auch im Hinblick auf das Panel ist
und in überhaupt gar keiner Weise irgendein Präjudiz bedeutet.
Herr Isermeyer, selbst wenn Sie sagen, wir müssen eine Zieldefinition
finden, stellt sich auch dann die Frage, wie die Opportunitätskosten
für eine Selbstversorgung in der Europäischen Union von
100 von 70 von 60 % sind und ob die Gesellschaft bereit
ist, diese Kosten zu tragen. Ich meine diesen Abwägungsprozess
können wir auch nach Durchführung des EU-Vorschlags vornehmen,
weil damit allenfalls die Kostenstrukturen in Ordnung gebracht
werden und unser eigenes Haus besser bestellt ist und weitere
Schritte auch von der Zielsystemdiskussion und ähnlichem
abhängen. Vielen Dank. |
| |
Dietrich Oetzel, InfoZentrum Zuckerverwender,
IZZ: |
| |
Ja die zentrale Frage, die immer wieder gestellt wird,
ist, was die zuckerverarbeitende Industrie nachher mit diesem
Preisvorteil tun wird. Ich möchte gern die Fragen von Ihnen
aufgreifen. So zwischen den Zeilen dringt da immer durch,
na ja das sind ja alles Peanuts pro Einheit, pro Tafel Schokolade,
pro Flasche Limonade, Gebäckstückchen oder sonst irgendetwas.
Sicherlich kann man so argumentieren, dass es Cent-Beträge
oder früher Pfennig-Beträge auch für das einzelne Produkt
sind und damit wäre überhaupt nicht relevant, ob nun dieser
Preis hoch oder runter geht. Ich möchte dem mal ganz entschieden
widersprechen, denn wenn wir diese Beträge mal hochrechnen
und wenn wir uns deutlich machen, über welche Werte wir
dort eigentlich sprechen, sind es ganz erhebliche Summen.
Sie haben vorhin konkret gefragt, wie viel denn an Zucker
in Deutschland in diesem Sektor eingesetzt wird. Wenn wir
von einer Produktion von 3,4 Mio. Tonnen A- und B-Zucker
ausgehen, 80 % hiervon. Also spreche ich über rund 2,7 Mio.
Tonnen, die verarbeitet werden. D. h. es sind ganz erhebliche
Beträge. Wenn wir über eine entsprechende Marktpreisabsenkung
runter auf 421 Euro, diese Zahl mal angenommen, reden, dann
sprechen wir auf EU-Niveau über Milliardenbeträge, die dort
zur Verfügung stehen und es sind halt keine Peanuts, um
bei diesem Unwort zu bleiben. Auch wenn Sie sagten, na ja
bei der Getreidepreissenkung haben wir bei dem Bäcker auch
nichts erfahren, sind die Preiskalkulationen hier nun mal
etwas schwieriger und aus einer ganzen Reihe von Preisfaktoren
zusammengesetzt. Es ist halt nicht nur der Rohstoff Zucker,
sondern der Kakao, die Arbeits-, die Lohnkosten usw. und
damit ist es eine relevante Größe. |
| |
Wenn wir uns in Deutschland die Handelslandschaft ansehen,
wissen Sie als Konsumenten, wissen Sie als Politiker die
Situation des deutschen Handels sehr genau einzuschätzen.
Die Margen, die dort verdient werden, sowohl im Lebensmittelhandel
als auch bei den produzierenden Betrieben als auch im Handel
selber, ich meine jetzt Edeka, Lidl oder Aldi, Rewe oder
wen auch immer dieser Welt, diese Margen sind sehr klein
und der Wettbewerb in diesem Sektor funktioniert und wir
haben einen sehr starken und ausgeprägten Wettbewerb. Wir
würden uns sicherlich auch Margen im Bereich von 4, 5, 6,
7 % wie in England in diesem Sektor wünschen. Das ist aber
nicht der Fall. Die Margen im Handel hier in Deutschland
liegen bei 0,8 % im Schnitt oder niedriger, siehe Karstadt.
Die Margen in unserem Sektor liegen auch vergleichbar wesentlich
niedriger. Der oft zitierte Mars-Riegel in Brasilien wird
übrigens aus Nordamerika importiert und ist auf Grund der
Importzölle preislich viel zu hoch einzustufen. Das ist
also ein Beispiel, was nicht zählen kann. Warum die Flasche
Coca-Cola dort so teuer ist, ich weiß es nicht. Wir haben
hier einen entsprechenden funktionierenden Wettbewerb und
Sie können davon ausgehen, dass sowohl bei Haushaltszucker
als auch bei der Fertigware dieser Wettbewerb funktionieren
wird. Wenn Sie reingehen in unsere schriftlichen Antworten,
werden Sie also sehen, dass selbst bei einer Preisüberwälzung
von nur 10 bis 20 % in der zuckerverarbeitenden Lebensmittelwirtschaft
der EU-Verbraucher mit 400 bis 700 Mio. Euro entlastet würde
und das sind halt keine Peanuts. |
| |
Gut, das war es zu dem Thema. Die Frage nach den 400.000
Beschäftigten habe ich nicht ganz richtig verstanden. In
der schriftlichen Antwort haben wir dort unterteilt, das
sind also 250.000 Beschäftigte im IZZ-Bereich, und das sind
400 in 3.000 Betrieben und es sind 400.000 Beschäftigte
in allen zuckerverarbeitenden Bereichen. Dann der letzte
Punkt Exporterstattung. Natürlich haben wir selbst bei den
Doha-Verhandlungen und generell WTO-Verhandlungen in anderen
Positionen mit gearbeitet und man weiß, wie kritisch dieser
Punkt Exporterstattung in den WTO-Verhandlungen immer wieder
hoch gekommen ist und eigentlich bräuchten wir keine Exporterstattung.
Wir können auf diesen ich sage mal ganz salopp – diesen
Juckepunkt in den WTO-Verhandlungen verzichten. Für uns
ist die Exporterstattung nur, ich sage nur, ein Nachteilsausgleich
für die zu hohen internen Marktpreise oder Rohstoffpreise
und dort vor allen Dingen für Zucker. Wenn diese Preise
auch auf Weltmarktpreis abgesenkt würden, und da wird sicherlich
gleich der Protestschrei kommen, dann bräuchten wir überhaupt
gar keine Exporterstattung. Mit Exporterstattung müssen
wir weiter leben, so lange die Preise nicht entsprechend
reduziert werden und wenn diese Exporterstattungen wegfallen
und der Zuckerpreis auf dem hohen Niveau bleibt, würde es
ganz erhebliche Probleme in unserem Industriesektor geben,
weil immerhin 10 bis 12 % der Produkte exportiert werden
und auch das sind keine Peanuts, das sind Arbeitsplätze,
die es gilt zu verteidigen. Last not least, der wirklich
letzte Punkt dann, bitte? |
| |
Abg. Norbert Schindler: |
| |
Sehen Sie keine Nachteile deswegen bei der Exporterstattung?
Sie stellen hier ein Szenarium in den Raum, das es bisher
noch nicht gegeben hat. Bis jetzt waren sie nicht mit Nachteilen
belegt. Sie waren geschützt durch die Exporterstattung. |
| |
Dietrich Oetzel, IZZ: |
| |
Das ist nicht richtig. Die Exporterstattungen sind, das
wissen Sie ja selber, im Nicht-Anhang-1-Bereich von annähernd
einer Milliarde auf mittlerweile 420 Millionen runter gegangen,
es finden ständig Kürzungen statt. Wir wollen jetzt nicht
in die Details einsteigen, aber es ist heute kein vollständiger
Nachteilsausgleich mehr. Letzter Punkt ganz schnell noch.
Sie haben vorhin gefragt, wie viel eigentlich der Kostenfaktor
Zucker in den einzelnen Produkten bedeutet. Wenn ich eine
Tafel Preiseinstiegsschokolade nehme, dann sind das rund
10 % am Verkaufspreis, 15 % an den Produktionskosten. Bei
Fruchtgummi 15 % bzw. 20 %, bei Dragees 35 %, Produktionskosten
40 %, Erfrischungsgetränke im Schnitt 25 % am Verkaufspreis,
Fruchtzuckerzubereitung in Milcherzeugnissen rund 30 %.
Also es sind relevante Kostenfaktoren. Die kann man nicht
vernachlässigen. Danke. |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Gut, wir fangen jetzt keine Diskussion um dicke Kinder
an. Also, herzlichen Dank. Herr Dietrich weiter. |
| Video |
Markus Dietrich, NGG: |
| |
Ich wurde zwar nicht direkt angesprochen, aber ich möchte
doch kurz auf die Fragen von Herrn Herzog eingehen, die,
so habe ich es verstanden, allgemein gestellt wurden. Zur
Isoglocose habe ich in meinen mündlichen Ausführungen keine
Stellungnahme abgegeben, weil ich die schriftliche Ausarbeitung
nicht wiederholen wollte. Ganz kurz, für uns ist es nicht
nachvollziehbar, warum man die Quote senkt und gleichzeitig
Isoglocose anhebt. |
| |
Die Frage der Vorfestlegung – ich will jetzt nicht noch
mal diesen Mengen- und Preiszyklus wiederholen, sondern
zwei Sätze zur Preisbildung sagen. Es ist weltweit im Zuckermarkt
kein freies Spiel der Kräfte vorhanden und wir halten es
für nicht legitim, dass man im Grunde genommen bei Verhandlungen
internationaler Art im Vorgriff in Vorleistungen geht und
diese, ich sage mal salopp, nicht tarifäres Handlungshemmnis
oder versteckte Subvention oder auch Monopolanbieter, was
es ja auch gibt, nicht berücksichtigt. |
| |
Die dritte Frage war die Datenlage. Ich halte sie für
nicht schlecht. Da möchte ich mich dem Herrn Ostendorff
anschließen. Wir haben ja schon öfter über die Zuckermarktordnung
geredet. Ich verweise auch auf den Bericht des Europäischen
Rechnungshofes. Zahlenmaterial liegt vor. Eine sehr gute
Datenlage kann man auch über die Lebensmittelzeitung erlangen
und ganz besonders möchte ich erinnern an den 30. Januar,
wo der Verband der Deutschen Süßwarenindustrie noch einmal
hervorgehoben hat, dass 80 % der Exporte in die EU-Länder
gehen und auch noch einmal kräftig gestiegen sind. Die Zahlen
sind sehr imposant. |
| |
Sie fragen mich, wo da die Wettbewerbsverzerrungen sind.
Was mich natürlich jetzt auch noch ein bisschen bewegt,
ist, was ich eingangs sagte. Das möchte ich noch einmal
aufgreifen. Ich befürchte Wettbewerbsverzerrungen innerhalb
der zuckerverarbeitenden Industrie. Der Spielraum – ich
wiederhole – wird größer und es werden kleine und mittlere
Unternehmen bei den Verhandlungen in Rückstand geraten und
dort sind unserer Meinung nach Arbeitsplätze gefährdet.
Ein Wettbewerb findet zwischen Handel und Lebensmittelindustrie
schon lange nicht mehr statt, auch das war schon öfters
Gegenstand von Anhörungen und zahlreichen Gesprächen. Wir
haben es mit einer Nachfragemacht des Handels zu tun und
auch die Süßwarenindustrie ist in der Vergangenheit mehrmals
Opfer dieser Nachfragemacht geworden. Ich frage mich, ob
so ein Szenarium nicht auch möglich ist, selbst wenn es
zu keiner Wettbewerbsverzerrung innerhalb der zuckerverarbeitenden
Industrie kommt und ob man sich dann nicht die Situation
vorstellen könnte, dass diese Preisnachlässe an den Handel
weitergereicht werden, der die Produkte dann unter Einstandspreis
verschleudert, der Marken und Handelsmarken gegeneinander
ausspielt. Und dann frage ich mich, wenn dieses Szenarium
eintritt, ob wir das wollen. Ich denke nicht. Ich möchte
betonen, dies sollte vermieden werden. Herzlichen Dank. |
| Video |
Peggy Fowler, OXFAM: |
| |
Ja vielen Dank. Ich möchte ganz kurz noch einmal auf
zwei Punkte zurückkommen, die angesprochen wurden. Das erste
Mal ging es natürlich um den gesunden Menschenverstand,
also das man den einsetzen muss. Wir fangen nicht bei Null
an, es gibt Gewinner und Verlierer. Wir verstehen natürlich,
dass das Regime oder die Marktordnung verändert werden muss.
Es gibt viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das
haben wir gehört und deswegen hat OXFAM einen sehr pragmatischen
Ansatz verfolgt bei der Formulierung der politischen Vorschläge. |
| |
Wir erkennen zwar an, dass es hier Preissenkungen geben
wird bei diesen Reformen, aber in erster Linie geht es natürlich
bei der Verfolgung der entwicklungspolitischen Ziele darum,
dass man sich auch auf die Quoten konzentriert und hier
ein stringenteres Quotensystem einführt, das dazu führt,
dass Exportdumping abgeschafft wird und den Marktzugang
der ärmsten Ländern verbessert und die AKP-Staaten stärkt,
die in einem Wettbewerbsumfeld überleben können und auch
Hilfspakete für die weniger gut aufgestellten Länder bereitstellt.
Noch eine Hinzufügung. Wir haben detailliert aufgelistet,
wie wir denken, dass das Quotensystem überarbeitet werden
sollte und welche Senkungen durchgeführt werden sollten
und wie diese Quotenveränderungen unter den unterschiedlichen
Entwicklungsländern aufgeteilt werden sollten, wo z. B.
LDC´s mit Produktionspotential und Exportkapazität verbunden
sind und wo Restriktionen festgelegt werden, z. B. für bestimmte
andere Maßnahmen. Also das haben wir auch noch formuliert.
Das wollte ich hinzufügen. |
| |
Ein anderes Thema, was man hier in diesem Zusammenhang
immer hört – die Umweltaspekte in diesen Entwicklungsländern.
Sehr viele Menschen haben hier Bedenken geäußert und OXFAM
macht sich natürlich auch große Sorgen darum, aber wir denken
folgendes: |
| |
Hier kann man dieses Thema nicht allein durch Handelsmaßnahmen
angehen, sondern man muss Anreizstrukturen bereitstellen,
damit diese Länder auch wirklich bessere umweltpolitische
Bedingungen schaffen. Handel allein ist keine Lösung. Wir
haben sehr viel Arbeit geleistet in Mocambique und Sambia.
Hier haben wir mit sehr einkommensschwachen Arbeitnehmern
in Zuckerraffinerien in Mocambique gesprochen und die haben
uns gesagt, wir würden es gerne sehen, dass die Lebensbedingungen
besser werden oder die Arbeitsbedingungen besser wären,
wir hätten natürlich gerne ein sehr viel höheres Gehalt,
aber wir wissen unseren Job auch sehr gut zu schätzen. Wir
haben keine Alternative in unserer Familie. Das Einkommen
ist niedrig, aber es ist unheimlich wichtig. Die Gewerkschaften,
die in dem Zuckersektor in diesen Ländern aktiv sind, sagen
auch ganz klar, selbstverständlich wollen wir Arbeitsbedingungen
fördern, aber wir wollen auch gleichzeitig Arbeitsplätze
sichern und mehr Arbeitsplätze schaffen. Wir denken also,
dass es gefährlich ist, wenn man den Leuten auf Grund schlechter
Umweltstandards und schlechten gesellschaftlichen Standards
die volle Auslastung ihrer Kapazität verwehrt, sondern wir
müssen sie mit langfristigen Perspektiven für die Zuckerindustrie
versorgen. Wir unterstützen auch Handelsmaßnahmen durch
Anreizmechanismen, so dass zusätzlicher Quotenzugang für
arme Länder bereitgestellt werden könnte, die sich an internationale
Arbeitsstandards halten. Natürlich ist es immer eine heikle
Frage, wer der Richter ist, ob diese Arbeitsstandards jetzt
erfüllt werden. Wie wir ja alle wissen, stehen die Entwicklungsländer
in der Welthandelsorganisation dem Thema der Arbeitsschutzmaßnahmen
mit einem gewissen Misstrauen gegenüber, dass sie das manchmal
auch als Feigenblatt für Protektionismus sehen, aber ich
denke, dass ist eine wichtige Maßnahme. Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit. |
| Video |
Dr. Hans-Jörg Gebhardt, WVZ: |
| |
Warum der Vorschlag von Fischler, warum zu diesem Zeitpunkt,
war das notwendig? Bekannt ist ja, dass Herr Fischler als
Agrarkommissar seinen Ausstieg, seinen Abschied erklärt
hat und vielleicht wollte er einfach noch einmal auf der
Weltbühne für sich ein Zeichen setzen, dass ihn heraushebt
als denjenigen der die Welthandelsgespräche, die ja ziemlich
ins Stocken geraten waren, wieder vorantreibt. Prädestiniert
als einer, der voranmarschiert ist gegen andere, die nichts
getan haben. Das ist die eine Seite und die andere ist die,
die auch angesprochen wurde: |
| |
Zucker ist der letzte Bereich, der noch nicht angegangen
wurde. Das Komische ist, das dies auch der einzige Bereich
der Landwirtschaft ist, der von den Betrieben noch werthaltig
geführt werden kann, wo die Betriebe noch ein Einkommen
verdienen. Nun kann man sich fragen, ob das durch die Reform
dann entsprechend so bleibt oder vielleicht noch besser
wird. Das zum Thema Fischler. |
| |
Die andere Frage war die Wertschöpfung oder der Produktionswert
des Zuckers in Deutschland. Der Zuckerproduktionswert wird
auf ca. 1,3 Milliarden Euro definiert. In der gegenwärtigen
Phase zieht daraus die Landwirtschaft eine Wertschöpfung
von 580 Mio. Euro. In der ersten Stufe – so sind unsere
Berechnungen - wären 50 % dieser Wertschöpfung weg. In der
zweiten Stufe mit der massiven Preissenkung würde gerade
noch der Produktionswert den Produktionskosten entsprechen
und damit wäre die Wertschöpfung Null in diesem Bereich.
Herr Dietrich hat ja schon kurz geantwortet auf die Frage,
wie die Rohstoffkosten für Zucker für die zuckerverarbeitende
Süßwarenindustrie sind und Herr Oetzel hat ja von einigen
Produkten große zweistellige Prozentzahlen genannt. Fakt
ist, wenn wir zu den Daten kommen, und da er die Kommission
zitiert hat mit dem Rechnungshofsbericht mit 6,5 Milliarden
Einsparpotential, muss er auch die andere Zahl zur Kenntnis
nehmen, die sagt, laut Kommission sind lediglich 5 % des
Einkaufswerts für Zucker der Anteil am Endproduktpreis für
den Verbraucher in der Summe. 5 % mit sinkender Tendenz.
Zum anderen ist es so, dass die zuckerverarbeitende Industrie
wie gesagt den überwiegenden Teil der Exporte innergemeinschaftlich
macht, aber das auch der Schutz dieses Wirtschaftsbereichs
durch die Einfuhrzölle ja gegeben ist. |
| |
Insofern hat die Süßwarenindustrie in den vergangenen
Jahren nicht schlecht mit der Zuckermarktordnung gelebt
und das merken insbesondere die kleinen und mittleren Betriebe
und es ist erstaunlich, dass genau diese jetzt in wachsender
Zahl zumindest noch hinter vorgehaltener Hand sagen, na
ja dann kann es doch für uns eher schwieriger werden, wenn
wir dieses alles wegräumen. |
| |
Herr Graefe zu Baringdorf, Sie sind kein großer Freund
der Zuckerindustrie, aber Freund der Rübenbauer doch wohl
und da muss ich Sie vielleicht noch mit einer Zahl aufklären.
Die Europäische Zuckerindustrie gehört mittlerweile zu ¾
den Rübenanbauern. Das sind in der großen Zahl Genossenschaften,
und wenn diese Genossen ihre Arbeit und ihre Verantwortung
richtig sehen, dann glaube ich schon, dass Sie wissen, wie
das Geld dort verteilt werden muss und niemand ist mehr
daran interessiert, dass die Zuckerindustrie eine stabile
Position behält, so wie sie sie jetzt hat, weil nur dadurch
auch die Rübenbauern ein entsprechendes Einkommen ziehen
können. Vielen Dank. |
| Video |
Dr. Rudolf Buntzel-Cano, EED: |
| |
Herzlichen Dank Frau Vorsitzende. Ich möchte gern zu
den Fragen von Herrn Herzog und Herrn Ostendorff Stellung
beziehen. Zu dem Mengengerüst aus Entwicklungsländerperspektive: |
| |
Es stimmt, natürlich haben Zollkontingente bestimmte
Nachteile. Herr Fischler ist ja nicht auf den Vorschlag
der LDCs eingegangen, also EBA 10 Jahre zu verschieben auf
2019 mit dem Argument, ein Mauritius reicht. Wofür steht
denn dieses Stichwort Mauritius? Natürlich für ein Land,
dass über hundert Jahre unter diesem Präferenzhandel Strukturen
aufgebaut hat, die sehr ineffizient und teuer sind. Nicht
nur Mauritius, sondern auch für die anderen großen Profiteure
des Zuckerprotokolls, wie Jamaika, Fidschi und Guyana, gilt
das Ähnliche. Also diese Länder sind absolut Hochkostenproduzenten
und hätten also unter anderen Bedingungen als unter dem
speziellen Zugang zu einem sehr geschützten europäischen
Markt keine Chance. Aber immer wieder werden hier verschiedene
Länder durcheinander geschmissen. Ich meine, dass sind zu
80 % die eigentlichen Profiteure von dem Zuckerprotokoll.
Wenn wir über die LDC´s reden, sind die zwar auch zum großen
Teil Mitglied im AKP, haben aber so gut wie gar keine Quoten
bekommen. Es sind vor allem die ost- und südafrikanischen
Länder, die ein sehr hohes Zuckerpotential haben. Das ist
erst einmal die große Ungerechtigkeit, dass sie nicht berücksichtigt
worden sind und zweitens würden diese Länder jetzt von EBA
profitieren. Wenn es also kein Mengengerüst gebe für sie,
dann würden sie also auf jeden Fall wettbewerbsfähig sein.
Swaziland gehört zu beiden Gruppen, aber die anderen, selbst
Malawi, das ist eins der ärmsten Länder dieser Welt, oder
Sambia ist wettbewerbsfähig natürlich unter der Bedingung,
dass sie neue Strukturen aufbauen. Sie haben bisher wenig
Zucker, aber der Zucker, den sie produzieren, ist recht
kostengünstig. Das zeigen Fallstudien aus diesen Ländern.
D. h., wenn sie nicht in ein Mengengerüst eingebunden werden,
würden sie auf jeden Fall auch expandieren, nur wahrscheinlich
unter extremen Bedingungen, nämlich einer Landnahme, die
auf Kosten der einheimischen Nahrungsmittelproduktion geht,
auf Kosten wahrscheinlich der biologischen Vielfalt der
Kleinbauern. Sie werden auf jeden Fall expandieren. Jetzt
ist die Frage, wie wir das in vernünftige Bahnen lenken
könnten und dafür sind die Zollkontingente, die sie ja selbst
angeboten haben, um auf ihren vollen freien Marktzugang
zu verzichten, ein geeignetes Instrument in einer Übergangszeit,
ich betone in einer Übergangszeit. Hier ist die Verhandlungsmacht
der dortigen Regierung gegenüber dem multinationalen Konzern,
vor allem sind es dort südafrikanische, und auch den Mauritiuszuckerkonglomerat
zu stärken, damit sie den Aufbau dieser neuen Zuckerindustrie
nicht nur wettbewerbsfähig, was es sowieso ist, gestalten,
sondern gleichzeitig auch sozial und ökologisch angemessen.
Deswegen ist das für uns der Hauptgrund, weswegen wir sagen,
im Übergang muss ein Mengengerüst her. Dann kann man darüber
streiten, ob der Übergang bis zum Jahre 2019 währen soll,
wie die LDCs das selbst vorgeschlagen haben oder bis zum
Jahre 2013. |
| |
Es gibt noch einige andere Vorteile von einem Mengengerüst
als nur die Verbindung mit den Standards. Es ist eine Infant-Industrie
und sie hat einen speziellen Schutz unter der WTO. D. h.
also, ein solcher Schutz des Mengengerüsts wäre WTO-konform
und es stellt einen Automatismus eines Ressourcentransfers
her, der anderweitig nicht gegeben ist, um diesen Ländern
zu helfen. |
| |
Da möchte ich kurz auf Herrn Schindler eingehen, der
sagte, also die deutschen Bauern hätten über die Finanzierung
der Reexporte des AKP-Zuckers Entwicklungshilfe geleistet.
Das ist natürlich nicht so, Herr Schindler. Als Großbritannien
in die EU kam, war Großbritanniens Markt total versorgt
von den AKP-Länder, diese berühmten 1,6 Millionen Tonnen.
Diese Importe haben wir übernommen, aber statt das wir den
Markt in Großbritannien auch den ursprünglichen Produzenten
weiter gelassen haben, hatte der Rest der europäischen Zuckerwirtschaft
um 1,6 Mio. Tonnen aufgestockt und dafür diesen Zucker wieder
reexportiert. Das heißt also, wir haben uns das angeeignet,
das waren ursprüngliche Märkte. Genauso ist es ja mit den
Präferenzen für Kuba und Brasilien, die nach Finnland geliefert
haben. Also wir können nicht sagen, dass ist eine Entwicklungshilfe,
die wir hier leisten, sondern das ist meiner Ansicht nach
eine Frechheit dadurch, dass wir zu einer bestimmten Zeit
einfach unsere Quoten hier erhöht haben, obwohl wir wussten,
dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und deswegen denke
ich, ist es auch wichtig, dass wir hier ein vernünftiges
entwicklungspolitisches Konzept zu Grunde legen, um zu sehen,
wie wir aus diesem Dilemma, das wir uns mit dem Zuckerprotokoll
und auch mit EBA selbst eingebrockt haben so raus kommen,
dass wir auch unseren Beitrag dazu leisten, dass in den
Entwicklungsländern vernünftige Strukturen entstehen. |
| |
Mit den AKP-Ländern haben wir das Zuckerprotokoll bis
auf ewig ja im Artikel 1. Das kann nur gekündigt werden,
dass ist das Problem, unter sehr restriktiven Bedingungen
oder überführt werden in andere, d. h. es bedarf eines großen
Verhandlungsgeschicks. Dieses Verhandlungsgeschick haben
wir nur, wenn wir den AKP-Ländern auch etwas anzubieten
haben. Was haben wir ihnen anzubieten? Vielleicht Handelspräferenzen
in ein paar anderen Bereichen, anstelle von Zucker, z. B.
bei Kaba oder so. Aber das primäre, was wir natürlich zu
bieten haben, sind Hilfen für einen Übergang. Wo kommt dieses
Geld her? Da möchte ich noch einmal wiederholen, dass es
ganz arg wichtig ist, dass das Geld was bisher in den Reexport
von AKP-Zucker gegangen ist, jetzt nicht einfach für die
Finanzierung von irgendwelchen Übergangshilfen hier im Inland
für die reformierte Zuckermarktordnung geschluckt wird,
sondern das muss sozusagen einem Herauskauf und einem vernünftigen
Aktionsprogramm für die AKP-Länder zur Verfügung stehen. |
| |
Und als Letztes möchte ich noch einmal sagen, dass Quoten
mit bestimmten ökologischen und sozialen Bedingungen zu
vergeben im Trend ist. Sie wissen vielleicht, dass die EU-Kommission
jetzt gerade ein General System of Preference plus aufgelegt
hat. Es werden nun also auch in anderen Bereichen zusätzliche
Marktzugänge vergeben an Entwicklungsländer, wenn bestimmte
ökologische und soziale Auflagen erfüllt werden. Das ist
zwar noch nicht ganz WTO-konform, aber es wird mit Sicherheit
akzeptiert. Also das ist eine Argumentationsschiene, die
wir sehr gut fahren können. |
| |
Abg. Norbert Schindler: |
| |
Ja Herr Buntzel-Cano, nur dass das auch noch einmal von
mir klar gestellt wird. Als die Maggie Thatcher damals unterwegs
war in diesem Kompromiss hat Deutschland damals die Nettozahlungen
zu Gunsten von Großbritannien um 2 Milliarden DM erhöht.
Die stehen heute noch und politisch bekamen wir die AKP-Geschichte
voll auf die Landwirtschaft aufgerechnet. Der Pakt der mit
Großbritannien geschlossen wurde, inklusive der Zuckerquote
war ein Gesamtpaket, was speziell Deutschland heute noch
Geld kostet; nur trockene Feststellung. Und wenn dann innerhalb
der Europäischen Union ein anderer Kompromiss herauskommt,
lass ich ihn mir von Ihnen so nicht aufrechnen. Tut mir
leid. Bis jetzt hatten wir eigentlich 80 bis 90 % Übereinstimmung
in den gegenseitigen Auffassungen, aber in dem Punkt nicht.
Im Politikum werden wir mitgenommen und die EU-Kommission
rechnet uns die Kosten da hoch und das war u. a. angeblich
auch Anlass für Fischlers Vorschläge. Da werden wir in Haftung
genommen. Wir sage ich jetzt, die europäischen Rübenanbauer,
bei dem Punkt. Beim Sozialtransfer über den hohen Preis,
geht es ja nicht nur um die AKPs. Was wir jetzt mit den
anderen Ländern noch drauf haben, hat doch schon christliche
Weltanschauung, den anderen zu helfen, mit dem hat es was
zu tun, aber wir Bauern kriegen es angerechnet, politisch
jedenfalls ganz massiv. |
| Video |
Prof. Folkhard Isermeyer, FAL: |
| |
Frau Vorsitzende, ich bin von den meisten Rednern angesprochen
worden, ich sehe, dass die Uhr vorantickt, ich werde versuchen,
es so kurz wie möglich zu machen. |
| |
Zunächst hatte Herr Herzog nicht nur mich, sondern die
ganze Runde noch einmal nach dem Datengerüst gefragt und
insbesondere ging es dabei ja um die internationalen Produktionskosten. |
| |
Soweit ich das sehe, gibt es nur sehr vereinzelt Fallstudien
zu einzelnen Ländern. Insbesondere möchte ich hinweisen
auf Arbeiten von Zeddies und Zimmermann aus Hohenheim, in
denen Zuckerrohrproduktionen in Südafrika, in Indien, in
Thailand und in Brasilien allesamt auf eine Größenordnung
von um die 200 vielleicht 250 Euro pro Tonne eingestuft
worden sind. Selbst das Zuckerrohr in den USA, die ja sowohl
Rübe als auch Rohr haben, liegt in der Größenordnung von
400 Euro pro Tonne. Vor diesem Hintergrund habe ich mich
nur gewundert, dass die EU-Kommission davon ausgeht, dass
eine ganze Reihe von Zuckerrohr produzierenden Ländern offensichtlich
weit über 600 Euro pro Tonne Vollkosten haben sollen. Das
reimt sich nicht so recht zusammen. Die EU-Kommission sagt,
da sind vielleicht noch 100 Euro inländische Transportkosten
aus entlegenen Lagen bis an die Küste, dass kann es aber
nicht ganz erklären. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären,
dass in diesen Ländern, die von der EU-Kommission als sehr
teure Produzenten ausgewiesen werden, sehr kleinbetriebliche
Strukturen vorhanden sind. In diesen kleinbetrieblichen
Strukturen hängt es natürlich sehr davon ab, wie sie die
Arbeitskraft bewerten. Ob sie sie mit 50 Cent pro Stunde
oder mit 70 Cent pro Stunde anrechnen, macht die Kosten
sehr hoch oder sehr niedrig. Nur geht es ja nachher darum,
wann steigen diese Länder aus und da zeigen unsere Erfahrungen,
die ich nur vom Bereich Milch oder Ölsaaten auf den Zucker
übertragen kann, denn da verfüge ich nicht über eigene Erfahrungen,
dass diese EU-Zahlen die Wettbewerbsfähigkeit der Drittweltländer
tendenziell wohl unterschätzen. Ich denke, dass wir an der
Stelle selbst dann, wenn die Zahlen als Zahlen in den Raum
gestellt werden, uns noch nicht zufrieden geben können,
denn es geht ja nicht darum wie hoch Durchschnittskosten
heute sind, sondern wie diese Kosten sich bei einer veränderten
politischen Situation verändern würden. Wir haben ja Anpassungsreaktionen,
darauf haben ja schon verschiedene Redner hingewiesen. Das
vermögen wir im Augenblick nicht zu analysieren, aber ich
denke, wir befinden uns alle miteinander in einem Blindflug
in die Globalisierung, wenn wir da nicht etwas mehr wissenschaftlichen
Diskurs und Klarheit in diese Kostendiskussion hineinbringen. |
| |
Frau Mortler hatte dann die Frage gestellt, ob ich diese
Strategie „Fit machen für den Wettbewerb“ noch einmal erörtern
könnte. Ich schätze es so ein, dass Europa sich auf Dauer
im Agrarbereich nicht einbunkern kann, d. h. wir haben nur
die Möglichkeit, in einem schrittweisen Prozess unsere Landwirtschaft
wirklich fit zu machen für den Wettbewerb, indem wir sie
möglichst mit marktorientierten Signalen versorgen und die
Einkommensstützung über andere Prozesse vornehmen, soweit
d´accord. Das wird bei den allermeisten Produktionszweigen
der Landwirtschaft dazu führen, dass sich die europäischen
Produktionskosten nach unten und sich die Weltmarktpreise
nach oben bewegen. Ein ganz eklatanter Fall ist in dieser
Hinsicht der Milchmarkt, wo wir natürlich einzelne Produzenten
weltweit haben, die sehr günstig und sehr preiswert produzieren
können, aber die können nicht die ganze Welt versorgen.
Deswegen zeigen alle Studien, dass uns bei einer Liberalisierung
die Weltmarktpreise entgegenkommen würden. Dann verlieren
wir in einer hypothetischen Freihandelssituation möglicherweise
10 oder 20 % Selbstversorgungsgrad, aber wir haben eine
Landung, mit der wir leben können. Und bei Zucker wage ich
dieses im Augenblick angesichts der mir vorliegenden Daten
und Analyselage zu bezweifeln. Denn wenn ich überlege, was
denn eine Liberalisierung bei Zucker letztlich hervorbringen
könnte, sehe ich, dass Brasilien einfach nur von der Mengenkonstruktion
her durch das Umlegen des Hahnes raus aus der Kraftstoff-
rein in den Zuckerbereich praktisch seine Produktion verdoppeln
kann, und, ich selbst habe mir das vor Ort angeschaut, durch
eine weitere Expansion der Fläche, die problemlos möglich
ist, zu lasten von Soja oder anderen Früchten locker die
Zuckerrübenproduktion der Welt auskonkurrieren könnte. |
| |
Wir haben bei Zuckerrübe und Zuckerrohr ein ganz spezielles
Wettbewerbsverhältnis. Es geht nicht nur um die landwirtschaftlichen
Produktionskosten, sondern auch um die Verarbeitungskosten,
sie haben da bei Zuckerrohr auch tendenziell Vorteile, längere
Kampagnendauer und vieles mehr. Und deswegen stelle ich
mir die Frage, ob es ein sinnvolles Szenario sein kann,
an diesen ersten Schritt Zuckermarktreform dann hinten noch
weitere Schritte anzuknüpfen, die nachher in den Freihandel
münden sollen. Es gibt eine gute Chance, dass dann ein Freihandel
ohne europäische Zuckerrübenproduktion stattfindet. Ob das
jetzt ein wünschenswertes Szenario ist oder nicht, dazu
kann und will ich nichts sagen, da muss ich wirklich dann
den Ball zurückspielen an die Politik. Da gibt es dann zwei
Antwortmöglichkeiten entweder das ist ein wünschenswertes
Szenario oder es ist keins. |
| |
Ich glaube, dass der Weltmarktpreis für Zucker, nachdem
was ich bisher dazu gelesen habe in einem Freihandelsszenario
nicht nachhaltig über 300 Euro pro Tonne zu liegen kommt
und ich sehe nicht, wie europäische Produzenten da auf Dauer
mithalten können und deswegen komme ich eben zu diesem Ergebnis. |
| |
Wenn man, und das ist jetzt wirklich eine Wenn-Dann-Aussage,
wenn man sagt, die Zuckerrübe soll hier dauerhaft erhalten
bleiben, dann ist es für mich eine sinnvolle politische
Strategie zunächst mal zu gucken, wie kriege ich das hin
und das aller Wichtigste ist dann eine Allianz. Dann muss
ich das in der WTO absichern, ansonsten führt allein das
EBA-Abkommen dazu, dass ich langfristig nicht Erfolg habe.
Und wenn ich diese Allianz herbeiführen will, dann muss
ich erst einmal mit den Partnerländern, mit meinen Bündnispartnern
reden, und muss gucken, was die für Vorstellungen haben
und dann ist es nicht unbedingt geschickt im allerersten
Schritt gleich mal die Preise so runter zu nehmen, dass
ein ganzer Teil der Bündnispartner sagt Dankeschön, aber
sorry wir steigen hier aus. Das ist also eine Frage eines
schrittweisen strategischen Vorgehens, was sich ableitet
aus einer politischen Zieldiskussion. Im weiteren Verlauf
und da möchte ich jetzt anknüpfen an den Kollegen Schmidt
und seinen Einwurf, muss man allerdings realistischer Weise
sehen, dass man auch bei Zucker um Preissenkungen nicht
herum kommen wird, davon bin ich fest überzeugt. Wir können
auch die europäische Zuckerwirtschaft nicht ewig in einer
defensiven Position einmauern, dazu ist die Findigkeit des
Handels letztlich über Kreislaufwirtschaft dann doch in
diesen extrem attraktiven Markt Ware einzuschleusen oder
auch die Lebensmitteltechnologie, die ja mit Zuckerersatzstoffen
noch weitere Fortschritte erzielen kann, einfach zu groß.
Auf Dauer können wir diese hohen Preise, das ist jedenfalls
meine Einschätzung, nicht halten und wir müssen auch sehen,
dass wir durch Quotenhandel in der EU grenzüberschreitend
die europäische Zuckerwirtschaft wettbewerbsfähiger machen.
D. h. auf Dauer werden wir wohl gar keine Alternative haben,
als zwar abgesichert aber eben doch möglichst nah am Markt
den Zuckeranbau zu organisieren. Nur wir müssen erst einmal
gucken, ob wir diese weltweite Allianz zustande bringen,
das ist für mich der allererste Schritt. Deswegen komme
ich zu meiner Politikempfehlung. Ob das dann überhaupt eine
realistische Strategie ist, wie Herr Goldmann oder auch
Frau Mortler gefragt haben, das mögen vielleicht die beurteilen,
die sich in der WTO-Rechtstexten besser auskennen, als ich
das kann. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass in der
WTO letztlich Verhandlungsergebnisse erzielt werden und
dazu müssen Interessen auf den Tisch gelegt und abgeglichen
werden. Dann ist es einfach so, dass ein Niedergang der
Europäischen Zuckermarktordnung den LDC´s den Ast absägen
würde, auf dem sie gerade eben sitzen und deswegen ist es
ein Interesse und deswegen haben sie ja angeboten mit diesem
tariff-rate quotas hier zumindest vorübergehend zeitweilig
ein umfassenden Mengengerüst aufzubauen. |
| |
Herr Priesmeier fragte dann, ob das möglicherweise dazu
führen könnte, dass man denen dann europäische Quote gibt.
Wir diskutieren hier schon rein rechtssystematisch, über
zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist die WTO, die allgemeine
Zollregeln und auch die Möglichkeit der tariff-rate quotas
vorsieht, wo man Importfenster länderspezifisch verhandeln
kann, dass andere ist dann die interne Umsetzung einer Zuckermarktordnung
in der Europäischen Union, was nur funktionieren kann mit
einer Zuckermarktordnung. Ich glaube, dass sind wirklich
zwei verschiedene Rechtsbereiche, die man nicht vermischen
kann. |
| |
Abschließend zu Herrn Schindler, Sie hatten gefragt,
wenn der Fischler-Vorschlag dazu führt, dass letztlich über
Kreislaufgeschäfte und dergleichen mehr Menge herein geschwemmt
wird und der Preis dann herabsinkt, weil wir keine Intervention
mehr haben, wie ist denn das zu beurteilen. Also das ist
ja eigentlich in zwei Teilfragen zu zerlegen. Die erste
Frage: |
| |
Gibt es überhaupt Kreislaufgeschäfte? Ich denke, die
Kontrolle wird außerordentlich schwierig sein, wenn man
die ökonomischen Anreize bedenkt, d. h. die Gefahr, dass
das LDC-Abkommen uns über Kreislaufgeschäfte hier den Zuckermarkt
überfüllt, ist sehr hoch, und deswegen plädiere ich klar
für eine umfassende Mengenregelung, denn ein Kreislaufgeschäft,
kommt ja dann in Gang, wenn ich die Menge nicht in irgendeiner
Form begrenze und nach oben den Zugang offen halte. Wenn
der Preis dann tatsächlich so stark unter Druck gerät, weil
eben keine Intervention mehr da ist, dann bleibt tatsachlich
nur vorübergehend kurzfristig der Bereich der Lagerhaltung,
aber das hilft nicht lange, weil ihnen die Lager überlaufen.
Sie müssen dann eine inferiore Verwertung als Biogas, Ethanol
oder was auch immer anstreben. Eine Intervention bringt
für mein Dafürhalten dann wenig, denn wir müssen uns vorbereiten
auf eine Zeit, wo wir keine Exporterstattung mehr anwenden
dürfen und dann bringt es auch nichts mit staatlichen Interventionslagern
zu operieren. Wir müssen dann tatsächlich die Mengenbegrenzung
noch stärker vornehmen als es bisher der Fall war. Kurzum,
ich glaube, wenn man die Zuckerrübe in der EU erhalten will
und ich will das aus meiner Sicht als offene Frage darstellen,
dann sehe ich keine realistische Alternative zu einer multilateralen
Vereinbarung in der WTO. Dankeschön. |
| Video |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
So jetzt haben wir es fast 14.00 Uhr und sind eigentlich
kurz vor dem Ende der Veranstaltung angekommen. Wir möchten
aber noch eine zweite Runde machen. Ich möchte aber mit
Ausnahme von Sascha Raabe, der vermutlich einen entwicklungspolitischen
Ansatz noch stärker als bisher in die Diskussion einbringen
will, darum bitten, vielleicht nur ganz konkret Fragen zu
stellen, also keine Statements mehr zu halten, wenn es irgendwie
möglich ist und dann auch um ganz kurze Antworten von denjenigen
bitten, an die dann die Fragen gestellt werden. |
| |
Abg. Dr. Sascha Raabe: |
| |
Vielen Dank, ich werde deshalb noch einmal ganz gezielt
Frau Fowler und Herrn Buntzel-Cano eine Frage stellen. Kurze
Vorbemerkung: |
| |
Ich bin als Entwicklungspolitiker oder generell auch
als Abgeordneter schon überrascht, dass hier einige neue
Theorien über Welthandel und Weltmarkt zum Teil auch von
den Vertretern der Wirtschaftsunternehmen mit aufgestellt
werden, indem oft gesagt wurde, dass Weltmarkt oder Weltmarktpreise
sich danach bestimmen sollten, dass ein Land nur für seinen
Eigenverbrauch produziert und das Brasilien als Böse dargestellt
wird, weil es über den Eigenverbrauch produziert. Also nach
dem Motto dürfte Deutschland auch nur so viele Autos produzieren,
wie in Deutschland verkauft werden und das ist schon eine
sehr eigenartige Logik von Welthandel, Weltmarkt und Weltpreisbindung
und in dem Sinne finde ich es auch manchmal etwas seltsam,
wenn von Seiten der CDU überall Freihandel und Marktwirtschaft
eingefordert wird, ausgerechnet in dem Agrarsektor und dem
Zuckersektor aber nicht. Ich bin Herrn Buntzel-Cano für
die letzte Stellungnahme dankbar, dass das Zuckermarktprotokoll
sicherlich kein sinnvolles entwicklungspolitisches Instrument
gewesen ist, sondern zu starken Fehlentwicklungen auch in
den AKP-Staaten geführt hat. So ist es in Jamaika. Da wird
Obst und Gemüse importiert, anstatt für die Tourismusindustrie
selbst anzubauen und es wird eine völlig veraltete Zuckerindustrie
aufrechterhalten. |
| |
Dann die konkrete Frage an Frau Fowler und an Herrn Buntzel-Cano
noch einmal zu den Übergangsfristen der Quoten, denn das
sollten wir auch alle ganz klar mitnehmen. Aus meiner Kenntnis
spricht sich sowohl OXFAM als auch die NGOs dafür aus, diese
Quoten auslaufen zu lassen. Es gibt eine Übergangsfrist.
Meiner Meinung nach, wir haben uns ja schon darüber unterhalten,
ist 2013 immer noch etwa zu lang, wir sehen es beim Textilfaserabkommen.
Auch dort warten die Länder dann immer auf den letzten Drücker,
um ihre Produktion zu modernisieren. Von daher könnte man
eine kürzere Übergangsfrist wählen, aber ganz konkret Frau
Fowler, Herr Buntzel-Cano, wie lange könnten Sie sich diese
Übergangsfrist vorstellen? Dann zum Thema Marktzugang. Bliebe,
wenn die EU ihren Marktzugang dann noch im Rahmen der WTO
nicht fair und gerecht öffnet, es geht ja darum Handelsschranken
abzubauen, neben Brasilien für andere Länder noch etwas
vom Kuchen übrig? Wir haben ja schon gehört, dass es wettbewerbsfähige
Länder auch in Afrika gibt. Wie schätzen Sie die Umwelt-
und Sozialbedingungen im Südosten Brasiliens ein, wo ja
die Wirtschaft am meisten expandiert? Da ist ja eine sehr
moderne Produktion gegeben. Ist es für Sie, eine letzte
Frage, nicht entwicklungspolitisch auch durchaus legitim,
wenn Brasilien Devisen erwirtschaften kann für sein Sozialprogramm,
wie das Nothungerprogramm, oder ist es, weil ja immer so
getan wird, als ob Brasilien hier auch europäische Zuckerrübenbauer
verdrängt, entwicklungspolitisch dann am Ende irgendwie
nachteilig? Also ich möchte das bezweifeln und wollte Sie
fragen, ob Sie da nicht auch ein entwicklungspolitisch legitimes
Interesse auch bei Schwellenländer sehen, auch für ihre
sozialen Programme Devisen zu erwirtschaften. |
| |
Abg. Dr. Christel Happach-Kasan: |
| |
Ich habe folgende zwei Fragen. Müssen wir vor dem Hintergrund,
dass wir seit 1992 beobachten, dass die Folge der Agrarreformen
eigentlich immer schneller wird, 1992 Sharry, 2000 Agenda
2000, 2003 Mid term-Review, nicht sehen, dass wir auch im
Bereich Zucker zu stärkeren Veränderungen kommen werden;
womöglich sogar stärker, als die Fischler- Vorschläge dies
beinhalten? Die erste Frage an alle, die sich dazu berufen
fühlen zu antworten. Ist es nicht realistisch anzunehmen,
dass wir weitere Reformen bekommen werden über das hinaus,
was Herr Fischler formuliert hat und müssen wir uns dementsprechend
darauf einstellen? |
| |
Und dann als zweite Frage:
Wir haben in der EU vergleichsweise hohe Umweltstandards.
Wenn wir hohe Umweltstandards erhalten wollen, bedeutet
dieses auch, dass wir die Produktion möglichst an den günstigsten
Standorten haben müssen, d. h. natürlich auch Olivenbäume
in Schleswig-Holstein ist unrealistisch. Die wachsen woanders
besser. Zucker in Schleswig-Holstein ist schon wiederum
realistischer und in Deutschland insgesamt auch realistisch.
D. h. müssten wir nicht vor diesem Hintergrund sagen, dass
die Handelbarkeit der Quote in der EU Voraussetzung dafür
ist, dass wir die Zuckerrübe überhaupt in Europa behalten. |
| |
Abg. Erika Mann, MdEP: |
| |
Danke schön, dass Sie mir die Möglichkeit geben, eine
Frage zu stellen. Ich komme aus dem Europäischen Parlament
und bin Handelspolitikerin in dem Bereich. Ich habe eigentlich
nur eine Frage, weil ich sie nirgendwo gesehen habe und
sie uns brennend interessiert in der Diskussion zur Vorbereitung
unseres eigenen Hearings. Es hat sich niemand von Ihnen
geäußert zur Übertragbarkeit der Erzeugungsquoten im Vorschlag
von Fischler, wenn Sie, das muss nicht hier sein, aber vielleicht
in der Zukunft mal dazu was sagen würden. |
| |
Abg. Gudrun Kopp: |
| |
Danke Frau Vorsitzende. Ich mache es ganz kurz. Ich habe
eine sehr konkrete Frage an Herrn Dr. Gebhardt. Herr Dr.
Gebhardt, wenn vorhin ausgeführt wurde, 28 Zuckerfabriken
in der EU, würden Sie einmal eine Prognose wagen, was bei
einem EU-weitem Quotenhandel passieren würde, wo ja eben
gesagt wurde, dass Deutschland recht gute Chancen hätte
für den weiteren Zuckerrübenanbau. Wie würde sich das möglicherweise
auswirken auf den Bestand von Zuckerfabriken in Deutschland? |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Dann schließe ich an und zwar an Herrn Gebhardt und an
Herrn Isermeyer die Frage, wie würden Sie denn Wettbewerbsfähigkeit
in Deutschland definieren, wenn Sie die Bereiche der erneuerbaren
Energien, also Bioethanol usw. und so fort mit einbeziehen
in diesen Sektor. Die zweite Frage geht an Herrn Graefe
zu Baringdorf und an Herrn Isermeyer: |
| |
Wie realistisch im Hinblick auf WTO, im Hinblick auf
EU und auch innereuropäischer Auseinandersetzung sind denn
welche Strategien? |
| |
Abg. Friedrich Ostendorff: |
| |
Eine Frage an Herrn Isermeyer. Herr Graefe zu Baringdorf
hat es gestreift. Wie würden Sie es beurteilen, einen neuen
betriebsindividuellen Zahlungsanspruch zu installieren.
Das widerspräche ja allem, was wir jetzt eingeführt haben.
Wir sehen das genauso wie Herr Graefe zu Baringdorf, aber
von Ihnen eine kurze Beurteilung dazu. |
| |
Das zweite wäre noch einmal zu Herrn Buntzel-Cano und
Frau Fowler vor allen Dingen, weil OXFAM hier argumentiert
hat, wie wir es bisher in Deutschland nicht kannten und
die OXFAM-Meinung hier nicht so sehr verbreitet war, dass
Sie sich auch für ein intelligentes Management des Quotensystems
in einem Übergang einsetzen, um den Ländern wirksam zu helfen.
Noch einmal eine Einschätzung, ob das so gemeinsam abgestimmt
ist, ob man mit dieser Position sagen kann, die ist sehr
nah beieinander zwischen Ihnen, hier das Quotenregime zu
nutzen, um diese 49 Länder zukunftsfähiger zu machen. |
| Video |
Prof. Folkhard Isermeyer, FAL: |
| |
|
| |
Erste Frage:
Sind stärkere Veränderungen zu erwarten als das was jetzt
auf dem Tisch liegt? Meine Antwort ist ja. Ich sehe, dass
wir bei den Zuckermengen deutlich runter müssen, egal ob
wir jetzt an der Zuckermarktordnung festhalten oder ob wir
uns auf irgendwelche Allianzen einlassen. Die 16 % werden
mit Sicherheit bei weitem nicht ausreichen. |
| |
|
| |
Zweite Frage:
Handelbarkeit der Quoten, dies wurde ja von zweien geäußert,
ist im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Zuckerwirtschaft längerfristig unumgänglich und umso erforderlicher,
je stärker wir die europäische Zuckermenge insgesamt runter
nehmen müssen. |
| |
Deswegen ein eindeutiges Ja zur Handelbarkeit der Quote. |
| |
Zu Frau Höfken – erneuerbare Energien. Ich habe hierzu
in der schriftlichen Stellungnahme ausgeführt, dass die
gesamte Ökonomik der erneuerbaren Energien zumindest in
der agrarökonomischen Forschungslandschaft Deutschlands
zurzeit wenig verankert ist, um nicht zu sagen, gar nicht
verankert ist. Ich finde das bedauerlich, wenn man bedenkt,
wie viel politische Hoffnung daran geknüpft wird und wie
viele Steuermittel auch schon jährlich in diesen Zweig an
konkreter Förderung hineingehen. Man muss sich ja grundsätzlich
die Frage stellen, ob es in einer künftig liberalisierten
Welt tatsächlich die richtige Arbeitsteilung ist, dass Deutschland
nachwachsende Rohstoffe produziert und Brasilien Nahrungsmittel,
oder ob das nicht anders herum vielleicht sinnvoller ist.
Dazu muss man aber mit wissenschaftlichen Methoden in diese
weltweite Arbeitsteilung hineinschauen und das geschieht
im Augenblick unzureichend. Ich denke, wir befinden uns
hier wirklich ein wenig im Blindflug in die Globalisierung
und laufen Gefahr, dass uns die WTO-Debatte irgendwann einmal
beim Bioethanol, beim Biodiesel und bei all diesen Dingen
schwer einholt. Denn im Augenblick haben wir ja noch einen
Schutz innerhalb dessen wir das betreiben, aber wenn der
Schutz mal wegfällt und der gerät ja irgendwann auch mal
unter Druck, dann wissen wir nicht, wie wir dann international
da stehen mit den nachwachsenden Rohstoffen. |
| |
Wie realistisch welche Strategie ist, dass können wahrscheinlich
die Politiker besser beurteilen. Ich glaube, dass die Richtung,
die sich hier ja verschiedentlich angedeutet hat, dass man
vielleicht bei den Preisen jetzt nicht ganz so stark runter
geht und sich vorbereitet auf eine stärkere Mengenkürzung,
dass dieses wohl von einer ganzen Reihe von Beobachtern
für realistisch gehalten wird. Wichtig ist, um die interne
Handelbarkeit von Quoten tatsächlich nachher operationalisierbar
zu machen, dass man dazu konkrete Ausführungsbestimmungen
erlässt, denn das erscheint mir im Augenblick noch ein bisschen
wolkig. Aus ökonomischer Sicht ist es dringend erforderlich,
das die Handelbarkeit kommt, aber wie sie denn rechtlich
ausgestaltet wird, wer mit wem in Handel tritt, dass bedarf
letztlich der juristischen Analyse. |
| |
Und zu Herrn Ostendorff abschließend zu betriebsindividuellen
Zahlungsansprüchen. Letztlich ist es ja so, dass hier die
Argumente für das Regionalmodell versus Betriebsmodell im
letzten Sommer umfänglich ausgetauscht worden sind. An diesen
Argumenten hat sich bis heute nichts geändert und insofern
spreche ich mich auch an dieser Stelle dafür aus, die Zuckerprämie
irgendwann in das Regionalmodell einfließen zu lassen. Wir
brauchen aus sozial-politischen Gründen zunächst mal betriebsbezogene
Ausgestaltungen. Wir können die Rübenbauern ja nicht über
Nacht im Regen stehen lassen. Wenn nun die Zuckermarktreform
vielleicht etwas später als 2005 oder 2006 beschlossen wird
und man trotzdem im Jahr 2013 zum regionalen Modell will,
dann braucht man eigentlich keinen Gleitflug für diesen
Zuckerbestandteil, denn dann kann man auch den Schnitt 2013
vollziehen. Denn wenn solche Prämienanpassungen früh genug
bekannt sind, können sich alle Wirtschaftsbeteiligten darauf
einstellen. Ich will mich aber schon dafür aussprechen,
dass wir im Jahr 2013 dann tatsächlich zu einem kompletten
Regionalmodell in Deutschland kommen. Ich halte es auch
politisch gar nicht anders für durchführbar, denn die Milchproduzenten
werden es politisch überhaupt nicht dulden, dass ihre Milchprämie
jetzt ab 2009 in die Ackerfläche gezogen wird und umgekehrt
aber die Rübenprämie dann nicht in die Grünlandflächen hineingeht.
Das wäre politisch überhaupt nicht durchzuhalten. Dankeschön. |
| Video |
Dr. Rudolf Buntzel-Cano, EED: |
| |
Zunächst einmal zwei Fragen von Herrn Dr. Raabe. Zunächst
einmal, was die Fristigkeit der Vorstellungen der Nichtregierungsorganisationen
in Bezug auf dieses Mengenkonzept angeht. Wir haben uns
in unserer Position mit dem LDC-Vorschlag einverstanden
erklärt und der hat eine Fristigkeit bis 2019. Ich persönlich
muss sagen, dass erscheint mit sehr lang. |
| |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein politisches
Programm für solange politisch durchkriegt, sondern bisher
sind alle Verlängerungen, auch der Zuckermarktordnung, maximal
über 6 – 8 Jahre gelaufen. Außerdem hätte ich die Befürchtung,
wenn wir wirklich eine Übergangsregelung für die LDCs bis
2019 schaffen würden, dass wir dann tatsächlich neue Mauritiusse
haben. Das heißt, dass ist meine persönliche Meinung, die
noch nicht mit dem Bündnis abgestimmt ist. |
| |
Die Frage mit Brasilien und was bleibt für Brasilien
übrig: |
| |
Erst einmal wird Brasilien natürlich mächtig profitieren
von der Tatsache, dass wir uns von den Weltmärkten zurückziehen,
denn diese Mengen wird Brasilien sofort und hoffentlich
nicht nur Brasilien auffüllen, das ist klar und im besten
Fall sind das ja 5 Millionen Tonnen. Viel mehr kann Brasilien
seine Exporte auch nicht steigern. Deswegen hat Brasilien
erst einmal gar kein Interesse in der jetzigen Phase Marktzugang
zu Europa zu kriegen, sondern sie haben ein Interesse daran,
Marktzugang zu den Drittlandsmärkten zu bekommen, die von
uns noch besetzt sind. Das sind die Märkte in Nordafrika,
im Mittleren Osten, dass sind alle die Märkte, die Herr
Koch von Töpfer auch noch geschützt haben will, weil wir
dort so schöne Hafenanlagen und Logistiken aufgebaut haben.
Ich meine, dass ist natürlich das Erste, was wir einbüßen
müssen, um also auch Brasilien noch Entwicklungschancen
zu geben. Dieses böse Bild, Brasilien der Teufel und wir
die Guten, kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Im
Nordosten von Brasilien herrschen natürlich feudale Verhältnisse,
da ist eine sklavenähnliche Situation auf den Plantagen,
das ist das alte Brasilien. Es gibt ein neues Brasilien
im Zentrum im Staate von Sao Paulo, wo die neuen Strukturen
sind, die auch die neuen Weltmärkte übernehmen werden. Da
sieht die Situation ja ganz anders aus. Das sind große kapitalistische
Betriebe, die sind voll durch geplant. Ich will nicht sagen,
dass dort die Verhältnisse gut sind, sie sind leider den
Weg der starken Mechanisierung gegangen, d. h. die Beschäftigungseffekte
sind nicht so positiv, wie man das sich wünschen würde.
Aber damit sind die Sozialbedingungen der Facharbeiter sehr
viel besser. Brasilien hat auf dem Papier natürlich hervorragende
Gesetze in Bezug auf Sozialstandards und Umweltstandards.
Das Problem ist, diese Gesetze werden in der Praxis nicht
eingehalten, weil das soweit draußen ist und da keiner so
richtig kontrolliert und die Zuckerbarone sind gleichzeitig
die lokalen Machthaber. Wie kann man also das, was auf dem
Papier steht, besser einfordern? Mit Sicherheit nicht über
Handelsboykott oder gar zu sagen, ihr dürft nicht, weil
ihr so böse oder so schmutzig seid, das ist kein Weg. Das
lässt sich auch international nicht durchsetzen. Sondern
nur durch die Stärkung z. B. der Organisation der Zivilgesellschaft
vor Ort, die ein Beschwerderecht kriegen, die aufpassen,
wenn so etwas passiert, dass das auch angeklagt wird, damit
Brasilien seine internen Widersprüche besser wahrnimmt.
Danke. |
| Video |
Dr. Hans-Jörg Gebhardt, WVZ: |
| |
Im Großen und Ganzen kann ich mich bei der Beantwortung
der Fragen auf die Ausführung von Herrn Prof. Isermeyer
stützen. Nur eine grundsätzliche Frage, wer macht denn die
Reform? Gehen die Reformen in der Zukunft nicht noch schneller,
als Fischler das mit seinen zwei Stufen vorgesehen hat?
Mein Weltbild ist so, dass die Regierung die Reformen schlussendlich
verantwortet und das bedeutet für mich, dass man dort ansetzen
und fragen muss, welche Reformen will man und was wird dadurch
bewirkt? Da muss man die grundsätzliche Frage stellen, die
Herr Isermeyer auch gestellt hat, wollen wir zukünftig noch
eigene Zuckerproduktion oder nicht und das trifft auch das,
was Herr Dr. Raabe in seinen Fragen niedergelegt hat. Diese
Antwort können nur die Politiker geben und die Wirtschaft
wird sich daran ausrichten. Frau Mann ist leider gegangen,
aber ich gehe davon aus, dass sie mit der Übertragbarkeit
der Quote den Quotenhandel gemeint hat. Die deutsche Zuckerwirtschaft
und im Übrigen auch einige wichtige Zuckerproduzenten in
Europa sehen dieser Transferierbarkeit der Quoten über die
nationalen Grenzen hinaus durchaus positiv entgegen. Nur
brauchen wir ein vernünftiges Regularium und es kann nicht
sein, dass dann linear gleich verteilt wird, sondern man
muss dann schon sehen, wohin die Quoten gehen und es ist
auch nicht so anzunehmen, wie manche das tun, dass sich
einfach ganze Länder verabschieden, sondern es gibt auch
in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliche Produktions-
und damit auch Kostenbedingungen. Insofern wird da einiges
in Fluss kommen. |
| |
Sie hatten zu Bioethanol gefragt. Da ist es natürlich
absolut richtig und es gibt auch ernst zu nehmende Politiker
und Wissenschaftler, die sagen, es macht doch keinen Sinn,
Nahrungsmittel über tausende von Meilen zu transportieren,
Food Miles einfach mal in den Raum gestellt, und die Energie
wird dann sehr teuer eingekauft. Hier ist ein Feld, dass
man entsprechend kanalisieren muss, aber die deutsche und
die europäische Wirtschaft erreicht in Bezug auf nachwachsende
Energien auch unter den hohen Rohölpreisen, die wir derzeit
haben, beileibe nicht die Wettbewerbsfähigkeit, sondern
sie kann nur leben, wenn hier entsprechende Mechanismen
da sind oder wenn z. B. auf die Steuer verzichtet wird. |
| |
Sie hatten dann noch gesagt, Brasilien will nur, und
das hat Herr Buntzel-Cano gesagt, in die Drittländer exportieren.
Da muss ich einfach noch einmal manifestieren, wenn sie
es nicht schaffen, die SWAP-Problematik und die strikten
Ursprungsregeln zu beherrschen, ist unser Markt tot. Denn
dann kommt dieser Zucker über die Drehscheibe herein bzw.
wir haben die Gesamtproduktion der LDC´s bei uns und dieses
wird nicht beherrschbar sein, weil sehr viel ausländisches
Kapital bereits in diese LDC-Länder hinein wandert, um dort
große Produktionskapazitäten aufzubauen. |
| |
Es ist möglicherweise zu einfach, wenn man sagt, wir
verlieren unter Berücksichtigung aller externen Faktoren
rund 40 % der Zuckererzeugung in Europa und damit auch 40
% der Fabriken. Die Beantwortung dieser Frage hängt sehr
stark mit der Transferierbarkeit der Quoten und der Ausgestaltung
dieses Systems zusammen. Wir werden mit Sicherheit auch
Fabriken und Arbeitsplätze verlieren, aber wir werden möglicherweise
weniger verlieren, wenn hier ein steuerbarer Wettbewerb
um die verminderten Quoten, die es zukünftig möglicherweise
geben wird, stattfinden wird, um die entsprechend zu allokieren.
Vielen Dank. |
| Video |
Peggy Fowler, OXFAM: |
| |
Vielen Dank noch mal. Um auf die zwei Themen, die an
mich gerichtet waren, zu sprechen zu kommen: |
| |
Zuerst einmal der Übergangszeitpunkt aus Sicht von OXFAM.
OXFAM hat ja dieses Rahmenwerk herausgegeben über Senkungen
der europäischen Produktionsquoten und den LDCs zwischen
dem Jahr 2006 und dem Jahr 2013. Also wir haben dieses Rahmenwerk
veröffentlicht und jetzt noch mal zur Frage, ob wir wirklich
davon überzeugt sind, dass Quoten z. B. eingesetzt werden
könnten, um die LDCs dazu anzuregen, einen wettbewerbsfähigen
Sektor zu machen? Ich denke diese Frage wurde motiviert
durch das Bedenken, dass wir dadurch vielleicht von Präferenzen
abhängige LDC-Länder sozusagen heranzüchten. Wir haben einige
Forschungen durchgeführt in einigen südafrikanischen LDCs,
aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich
entwicklungspolitisch Sinn macht, einen Schutzzeitraum oder
einen Übergangszeitraum für diese Länder bereitzustellen.
Sie sind die kostengünstigsten Produzenten von Zucker in
der Welt und wir denken, dass sie auch langfristig sehr
gutes Potential haben, nachhaltige Industrien zu entwickeln,
wenn man ihnen genug Zeit und genug Unterstützung gibt in
diese Sektoren zu investieren, insbesondere in das Transportwesen.
Im Transportwesen sind sie aus Kostenperspektiven auch benachteiligt
und da brauchen sie Zeit, um das aufzubauen. Uns geht es
hier nicht darum, dass wir jetzt einmal sagen, nein keine
Intervention, keine Verzerrung, sondern wir müssen uns die
Situation, die Geschichte mit dem Zucker und die historischen
Verbindungen mit den AKP-Staaten und die Tatsache anschauen,
dass die LDCs auch weiter entwickelt werden müssen. Das
SDT, Special Differential Tradement, wird von der WTO für
die LDCs anerkannt und wir als entwickelte Staaten haben
nun einmal eine Verantwortung, da diese Fragen alle große
Implikationen aufwerfen werden. |
| |
Jetzt zum Thema Brasilien, ich stimme sehr vielem zu,
was hier gesagt wurde. Ganz sicher muss man hier langfristig
das Thema angehen und hier geht es darum, dass man auch
ein Umdenken oder Umlenken in diesem Bereich einläutet und
dass man hier die Gewerkschaften und die Zivilgesellschaft
fördert. Das wurde ja von einem Vorredner bereits erwähnt.
Im Fall vom WTO-Panel haben wir gesehen, dass es Brasilien
in erster Linie darum ging, das Exportdumping durch die
EU zu begrenzen und der Panel-Bericht hat ganz klar gezeigt,
dass es kein Interesse an der Beendigung der Präferenzen
der EU gibt. Und ich denke, dass ist etwas sehr Wichtiges,
was die EU berücksichtigen sollte. |
| Video |
Prof. Dr. Schmidt, IZZ: |
| |
Ich möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es
ja bei der Reform der Zuckermarktordnung darum geht, sie
einzubeziehen in die Agrarreform und da sind klare Setzungen
getroffen worden, sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland.
Mehr Leistungs- mehr Verteilungsgerechtigkeit und das bedeutet,
Ausrichtung der Produktionskosten an den Marktverhältnissen
auf der einen Seite und verteilungspolitisch Ausgleich durch
Direktzahlung. In Deutschland ist aus politischen Gründen
das Modell Direktzahlung Regionalmodell gewählt worden,
und es gibt überhaupt keinen Grund den Zuckersektor auszunehmen.
Man müsste schon eine Sonderrolle des Zuckermarktes konstruieren,
die m. E. nicht gegeben ist, genauso wenig wie eine Ausnahme
von der grundsätzlichen Ausrichtung der Agrarreform. Die
Frage ist, welche Schritte möglicherweise noch notwendig
sein könnten. Ich meine im Gegensatz zu Herrn Isermeyer,
dass das Reformkonzept der Kommission in überhaupt keiner
Weise, irgendwelchen internationalen Verhandlungen entgegensteht.
Im Gegenteil. Ich meine, den Schritt die Preise zu senken.
Die Quote bleibt ja mit einer Reduktion erhalten einfach
um die Produktion in Grenzen zu halten oder auf das notwendige
Maß zu beschränken. Diese Preissenkung wird das erste Ziel
der Leistungsgerechtigkeit stärker erreichen und wird zu
Kostensenkungen führen. Das brauchen wir, weil wir in anderen
Bereichen eben auch auf dieselbe Schiene setzen. |
| |
Ein Wort noch zu den Importzöllen. Von Importzöllen gleich
Null spricht kein Mensch. Das wird auch im internationalen
Rahmen überhaupt nicht diskutiert und dieses Ungeheuer Brasilien
wieder auf den Tisch zu holen, scheint mir ohne polemisch
zu werden, irgendwie weltfremd. |
| |
Der dritte Punkt, die Handelbarkeit, ich habe das vorhin
schon gesagt, halte ich für außerordentlich wichtig. Die
deutsche Seite sollte darauf achten, wie die Franzosen das
auch schon durch Duval und andere Leute gesagt haben, den
Handel mit Quoten zu unterstützen. Darauf sollte Deutschland
gesteigerten Wert legen. Es geht um die Definition des Weißzuckerwerts,
wahrscheinlich mit, vor oder ohne Quotenkürzung und ganz
entscheidend darum, wie der Handel stattfindet, wobei nationale
Besonderheiten zu berücksichtigen sind. Die Quotenkürzungen
wirken sich in allen Ländern sehr unterschiedlich aus. |
| |
Und der letzte Punkt ist natürlich die Frage des Schaffens
von Regeln und der Organisationsform. Wir brauchen eine
Handelsplattform, die auch nicht durch politische Einflüsse
von wem auch immer in den südeuropäischen Ländern konterkariert
wird, vielleicht soweit. Danke. |
| Video |
Dr. Hans-Jörg Gebhard, WVZ: |
| |
Es schließt an die Frage des betriebsindividuellen Ausgleichs
bzw. des Einordnens des Zuckerbereichs in die Reform der
gemeinsamen Agrarpolitik und der Sondersituation in Deutschland
und den Sonderweg, den Deutschland beschreitet, an. Wir
möchten dringend bitten, nicht zusätzliche Wettbewerbsverzerrungen
innerhalb Europas zuzulassen in der Ausführung der unterschiedlichen
Transferzahlungen. Ein Regionalmodell, wie wir es haben
und im Abschmelzungsgedanken der hier eingebaut ist, stellen
sich die deutschen Rübenanbauer wesentlich schlechter als
die Anbauer in Frankreich. Dementsprechend würde auch der
Quotenhandel dadurch verzerrt, weil durch die betriebsindividuellen
Zahlungen in Frankreich natürlich mehr Geld vorhanden wäre,
um auch höhere Quotenpreise zu bezahlen. D. h. wir fordern
hier eine Gleichbehandlung für den Ausgleich, den wir für
Preis- und Mengensenkung über Europa insgesamt brauchen. |
| Video |
Christian Bär, DBV: |
| |
Frau Vorsitzende ganz kurz aus gebotener Zeit zu den
Produktionskosten. Ich denke, hier kann und darf man die
ökologischen und sozialen Standards nicht außer Acht lassen,
die letztendlich auch in die Handelsbeziehungen aufgenommen
werden könnten. Das ist einer der wenigen Momente, von denen
ich glaube, dass sie wirksam greifen können, wenn wir eine
vernünftige Zuckermarktordnung umsetzen wollen. Herr Prof.
Schmidt ich bin nicht Ihrer Auffassung, Brasilien als weltfremd
zu bezeichnen. Vielmehr erscheint es mir auf Grund meiner
Kenntnis weltfremd, Brasilien nicht mit der Bedeutung zu
belegen, die es im internationalen Bereich der Agrarproduktion,
Möglichkeiten und der Standards hat, die dort angesetzt
werden. Mir ist bekannt von einem portugiesischem Kollegen,
dass dort auch heute noch Rodeprogramme aufgelegt werden
mit dem einzigen Ziel und der einzigen Verpflichtung, die
Dinge, die dort produziert werden auf dem Weltmarkt unterzubringen.
Ich will das aus Zeitgründen nicht weiter ausführen, aber
es gibt eine ganze Reihe von Punkten, von denen ich glaube,
dass man sie nicht außer Acht lassen darf. Abschließend
noch eine Antwort auf die Frage, ob es denn Versuche gibt,
Verbündete zu suchen. Der Deutsche Bauernverband sucht Verbündete.
Wir führen selbstverständlich auf europäischer Ebene Gespräche
mit den Franzosen und mit den polnischen Rübenanbauern,
dies in Brüssel und in Straßburg und wir haben darüber hinaus
auch auf Grund unserer internationalen Beziehungen auch
Gespräche mit den Amerikanern aufgenommen, um hier vernünftige
Regelungen zu finden. Letztendlich auch in Europa. |
| |
Das ist der Ansatz, Zuckerüben im Rahmen der hier auch
angedachten handelspolitischen Möglichkeiten zu produzieren.
Vielen Dank. |
| Video |
Henning Koch, Fa. August Töpfer: |
| |
Ich wollte nur mal zu meinem Lieblingsthema Weltmarkt
zurückkommen, zu ein paar Zahlen, die hier genannt worden
sind. Sie Herr Prof. Isermeyer haben eben gesagt, dass Ihnen
Studien vorliegen, dass der Weltmarktpreis nicht über 300
Euro gehen kann. |
| |
Ich möchte einfach daran erinnern, das wenn wir vom jetzigen
Maipreis von 260 Dollar ausgehen und den umrechnen zu einem
Dollarkurs von 82 Cent, wie wir ihn vor nicht allzu langer
Zeit gehabt hatten, dann ist das schon alleine ein Preis
von über 300 Euro. Außerdem möchte ich gar nicht auf die
Exzesse in den 70er und 80er Jahren zurückgehen. Aber auch
in den 90er Jahren hatten wir Preise, die deutlich über
400 Dollar lagen. Ich habe jetzt die Umrechnungskurse nicht
dabei. Also Preise deutlich über den derzeitigen Preisen
sind jedenfalls in der jüngsten Vergangenheit Realität gewesen. |
| |
Etwas anderes ist auch wichtig in diesem Zusammenhang.
Der Weltzuckerverbrauch steigt kontinuierlich. Man rechnet
in den letzten Jahren mit Werten von über 2 ½ %. Bleiben
wir nur mal bei 2 %, dann würde das auf das gegenwärtige
Niveau bezogen in 10 Jahren fast 20 Mio. Tonnen mehr an
Weltbedarf bedeuten. |
| |
Jetzt gab es wiederum eine Diskrepanz zwischen Ihrer
Aussage und der von Herrn Buntzel-Cano. Sie haben gesagt,
Brasilien kann schnell umlegen von Alkohol auf Zucker. Das
ist zwar korrekt, aber man muss fragen, warum sollten sie
das tun bei Energiepreisen von 55 Dollar pro Barrel. Auf
der anderen Seite sagten Sie, Herr Buntzel-Cano, die Brasilianer
könnten nur weitere 5 Mio. Tonnen exportieren. |
| |
Also das ist für mich neu und widerspricht allem, was
man über die Programme, die dort laufen, weiß. |
| |
Es wird ja weiterhin ernsthaft darüber nachgedacht, gerade
Viehwirtschaftsfläche umzuwandeln zu Zucker und wir haben
alleine nach den gängigen Schätzungen vom gegenwärtigen
Jahr bis zum nächsten Jahr schon mal eine Rohrsteigerungsprognose
von fast 10 %, um genau zu sagen von 9 %. |
| |
Die Brasilianer sind munter dabei und sie bauen auch
neue Terminals und neue Fabriken. Ich würde es für einen
wichtigen Faktor für den Weltmarkt und die Beurteilung der
zukünftigen Preisentwicklung halten, wenn wir davon ausgehen
könnten, dass die Brasilianer mit weiteren 5 Mio. Tonnen
zufrieden sind. Danke. |
| Video |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, AbL: |
| |
Wir sind dagegen, dass die Rücknahme dessen, dass was
ich Pervertierung genannt habe, mit Steuergeldern finanziert
wird. Die für die Prämie angedachten 1,5 Milliarden Euro
gehen besser in einen Fond, von dem ich vorhin gesprochen
habe, der für die ländliche Entwicklung eben auch in diesen
Zuckerbereichen zur Verfügung stehen soll. Für die Rückführung
der Menge bei ausreichenden Preisen bedarf es keiner Prämie,
sondern die Zuckerrübenbetriebe haben über das Modell, das
Deutschland gewählt hat, demnächst bereits eine Prämie,
weil sie mit reinkommen und das muss an Entschädigung genug
sein. Ich meine sogar, dass es hier zu einer moderaten Preissenkung
kommen könnte, nicht als Systemwechsel, sondern nur in der
Relation zu dem was da an Vorteilen jetzt kommt. |
| |
Zu der Frage der Vorsitzenden, ob das in der WTO durchführbar
ist. Ja, in der WTO ist eine Menge durchsetzbar und man
sieht ja wie auch das WTO-System unterlaufen werden kann
und trotzdem negative Resultate kommen. Der C-Zucker ist
ja nach WTO-Regeln erlaubt, weil er nicht subventioniert
wird und die Bauerngelder spielen dabei keine Rolle. Man
kann ihn eigentlich auf den Weltmarkt bringen und das sieht
man an der Klage, wie sie jetzt im Panel vorliegt. Sie konstruieren
eine Verbindung mit dem überhöhten Preis in den anderen
Bereichen. Es gibt ja auch eigentlich keinen Sinn, dass
sie C-Zucker anbauen. Warum tun es die Bauern? Natürlich
hat das mit dem anderen zu tun. Ich wollte nur sagen, sie
konstruieren und sie müssen es konstruieren, um daraus einen
Verstoß gegen die WTO-Ordnung zu machen. Dennoch sind diese
3 ½ Mio. Tonnen Dumping, das ist Dumping, wo immer das Geld
herkommt. Das muss weg und das muss auch in die Regel einbezogen
sein. Das muss auch im Abkommen deutlich werden, sonst wird
man diese Interessenslage von der Herr Isermeyer sprach,
die man schmieden muss, um in der WTO ein Ergebnis zu erreichen,
nicht erreichen. Nur in diesem Zusammenhang habe ich gesagt,
ist es vielleicht sinnvoller das in die Biogasanlage zu
tun oder in die Spritherstellung. Ob man besser für den
Spritt produziert als für die Nahrungsmittel und ob das
für die Bauern tatsächlich gut ist und ob sie die Ölscheichs
von Morgen werden, da habe ich meine Bedenken. In der jetzigen
Konstellation rechnet es sich jedenfalls mehr, das hat damit
zu tun, weil wir das Einspeisegesetz haben und folglich
könnten wir auch gut darauf verzichten. Das ist eine Frage
für die Zuckerindustrie, die natürlich an Kapazität verliert.
Jedenfalls wenn sie in die Biogasanlage geht. Nun haben
wir das Glück, dass das Landproblem noch nicht ganz gelöst
ist. Vielleicht läuft es ja doch durch ihre Kapazitäten,
dann sind sie damit weiterhin ausgelastet. |
| |
Ich wollte zu der zuckerverbrauchenden Industrie noch
etwas sagen. Sie haben von den 10 oder 12 % Export gesprochen.
Wir haben aber bereits, dass wissen Sie auch, im Zuge des
Abbaus der Exporterstattungen oder der Reduzierung auf eine
Menge den sog. einfachen Grenzverkehr, den vereinfachten
Veredelungsverkehr. D. h. Sie können auch Zucker im Weltmarkt
zu den Bedingungen des Weltmarktes kaufen und können, wenn
Sie sicherstellen, dass das in Produkte geht, die sofort
wieder rausgehen, diese Verbilligung wahrnehmen. Es gibt
für die chemische und die pharmazeutische Industrie seit
langem die Möglichkeiten auf dem europäischen Markt zu Weltmarktbedingungen
zu kaufen. Also hier sind für sie ja Regelungen geschaffen.
Wenn Sie das hier anführen, sollten Sie das wenigstens auch
mit nennen. Dass das etwas kompliziert ist, ist die andere
Frage. Ich bin auch nicht sehr interessiert an dieser Regelung,
aber sie ist eben mal von der Kommission geschaffen worden.
Also, die Frage werden wir das durchsetzen? Ja, wir werden
es durchsetzen auf der europäischen und der WTO-Ebene, davon
bin ich überzeugt. Nicht alle werden zufrieden sein, aber
es wird Gott sei dank keinen Fall der Zuckermarktordnung
geben, weil das Instrumentarium erst mal historisch gewachsen
ist und uns Möglichkeiten der Umgestaltung bringt. |
| |
Wie lange das dann noch notwendig ist, muss man sehen.
Es ist schwierig, die verschiedenen Interessenslagen unter
einen Hut bringen. Möglicherweise nicht ganz Ihre, aber
ich bin da auch nicht ganz so sicher, wie weit Sie nach
außen hin Ihre Position so darstellen müssen, wie Sie es
tun und heimlich vielleicht doch hoffen, dass sie weiterhin
durch die Zuckermarktordnung guten Zucker kriegen. |
| |
Amt. Vorsitzende, Ulrike Höfken: |
| |
Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die ausführlichen
und guten Beantwortungen der vielen und ebenso ausführlichen
Fragen. Ich denke, Sie haben uns geholfen, dieses Thema
weiter im Ausschuss zu diskutieren und die politischen Entscheidungen
zu treffen, wo ja ganz richtig gesagt wurde, dass wir sie
zu treffen haben und wir nehmen dieses als eine gute Grundlage.
Herzlichen Dank auch an unsere Gäste und an die Kolleginnen
und Kollegen, die jetzt diese Form der Weiterbildung genossen
haben. |
|
|